
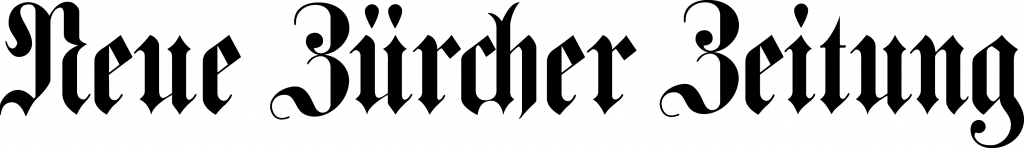
Maurizio Ferraris 19.03.2020
- Liebe Leute, wollt ihr denn ewig leben?
- Sammlung
- Krise
- Biosphäre
- Projekt
- Kosmopolitismus
- Nationale Souveränität
- Globalisierung
- Medizin
- Tod
Liebe Leute, wollt ihr denn ewig leben?

Mein Grossvater stand an der zwölften Isonzoschlacht im Ersten Weltkrieg an der Front, und er fand dies völlig normal oder jedenfalls geboten. Ich bin seit geraumer Zeit von der Regierung verdonnert, zu Hause zu bleiben, in meiner Wohnung in Turin, also gewissermassen ebenfalls an der Front, allerdings umgeben von Unmengen an Büchern und CD. Dies scheint mir nicht nur gemessen am Einsatz meines Grossvaters eine privilegierte Situation zu sein, sondern auch in Bezug auf einen Gutteil der Menschheit, die bis heute gelebt hat. Indem ich von meiner (und Ihrer) frei gewordenen Zeit profitiere, notiere ich, was mir dieser Tage durch den Kopf geht.
Sammlung
Bis vor kurzem hörte man ständig irgendwelche Klagen über die Flut an Nachrichten, die uns täglich, stündlich, ja im Minutentakt heimsucht, über das «cogito interruptus», das ständig unterbrochene, denkunfähige Ich. Ich weiss nicht, wie aufrichtig diese Jeremiaden waren, aber bestimmt haben sie heute jede Daseinsberechtigung verloren. Was mich anbetrifft, so fühle ich mich ein wenig wie Proust. Der Schriftsteller schrieb und überarbeitete seine «Recherche» während des Ersten Weltkriegs, als er sich aufgrund einer Krankheit von allen sozialen Pflichten entbunden fühlte und ohne Aussicht war auf eine unmittelbare Publikation. So arbeite ich jeden Tag an meinen Notizen, weniger ziseliert natürlich, aber doch akribisch, ohne an das Morgen zu denken. Ich bin desorganisiert, im besten Sinne. Die Isolation mag (oder möge) noch lange anhalten.
Krise
Ich kann jetzt schon den Einwand hören: Schön für dich, Herr Professor, dass du nun an deinen Büchern arbeitest und aus der Notsituation Profit ziehst. Aber was ist mit den anderen? Gewiss, vielen anderen ergeht es schlechter als mir, den Ärzten in erster Linie. Stimmt. Aber aus dieser Krise, in der es ums Leben geht und nicht nur ums Geld, muss man am Ende mit einem Bestand an guten Ideen und auch gutem Willen hervorkommen. Wenn es ums Leben geht, muss am Ende auch ein Sieg des Lebens stehen – eine neue Lust, zu leben und zu schaffen (ich habe Kollegen in Wuhan, die mir versichern, dass genau dies ihr Seelenzustand sei).
Biosphäre
Die Epidemie erinnert uns nebenbei auch an eine Selbstverständlichkeit, die wir gerne vergessen, wenn wir, nicht ohne Naivität, das Web als eine Infosphäre beschreiben, als eine virtuelle Welt, die langsam, aber sicher unsere reale Welt verschlingt. So verhält es sich offensichtlich nicht. Die künstliche Intelligenz nährt sich von der natürlichen Intelligenz, sprich: von unseren Verhaltensweisen, und diese werden bestimmt durch den Umstand, dass wir Organismen mit einem Stoffwechsel sind, der uns den Rhythmen des Lebens aussetzt. Das Web ist keine Infosphäre, sondern eine Biosphäre, eine Umgebung, in der das Leben aufgezeichnet, berechnet und in seinen Regelmässigkeiten abgebildet wird. Es ist das Leben, das die Zeiten und die Dringlichkeiten, die Präferenzen und die Bedürfnisse diktiert, sowohl unter normalen wie unter den aussergewöhnlichen Umständen, die wir gerade erleben.
Projekt
Auch in der digitalen Biosphäre können wir uns anstecken – mit den Ideen der anderen. Wir sitzen vor dem Bildschirm und sind mit den Lebensrhythmen unzähliger anderer Menschen verbunden. Wir haben unendlich Zeit für Reflexion, Projektion und Planung. Wir beginnen mit dem Nebensächlichen: Wie lässt sich ein Fernunterricht organisieren? Wie lässt sich Telearbeit verrichten? Was ist der höhere Sinn von Home-Office? Und so schreiten wir fort, zu den Dingen von längerem Atem, zu den grossen Fragen, an deren Ende die eine Frage steht: Wie wollen wir leben? (Wie wollen wir leben als Individuen? Und wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben?)
Kosmopolitismus
Alle diese Projektionen – oder Projekte – haben eine kosmopolitische Bedeutung. Denn das Virus gemahnt uns an etwas, das uns der gesunde Menschenverstand nie vergessen lassen sollte, dass nämlich die Erde rund ist. Dass also die Menschen – wie übrigens auch die Viren – dazu bestimmt sind, miteinander in Kontakt zu treten, statt sich zu zerstreuen. Nicht nur die Viren, auch die Ideen kennen keine Grenzen. Das Virus ist zweifellos weniger interessant als die Ideen, aber aus dem Virus können – wie aus jeder Komplikation – gute Ideen hervorgehen. Auch das ist eine Infektion – eine positive.
Nationale Souveränität
Wer trotz neu gewonnener Musse keine guten Ideen entwickelt, kann dessen ungeachtet versuchen, die schlechten Ideen zu widerlegen. Manche werden es bemerkt haben: Plötzlich hat man in Italien aufgehört, von der Rückeroberung der nationalen Souveränität zu reden. Dieselben, die bis vor kurzem dazu aufgefordert haben, die Migranten aus dem Land zu werfen, beklagen sich nun darüber, dass die Italiener wie Pestkranke behandelt werden. So ändern sich die Zeiten. In Wahrheit wollten die Souveränitätsapostel nicht die Souveränität, sondern bloss ihre (vermeintlichen) Privilegien sichern. Damit erweist sich der «Sovranismo» (wie wir in Italien sagen) als das, was er eigentlich ist: Egoismus. Man kann ihn nobilitieren, wie dies Antonio Salandra tat, der um 1900 in zahlreichen Regierungen sass, als dieser vom «heiligen Egoismus» sprach. Aber dies ändert an seiner Natur nicht das Geringste. Das Hochhalten der nationalen Souveränität gilt nur so lange, als man selbst davon profitiert – aber wenn die Folgen drastisch sind, zum Beispiel wegen eines Virus, ist sie plötzlich nicht mehr dringend.
Globalisierung
Die Globalisierung ist aus denselben Gründen wie der Kosmopolitismus (im Wesentlichen: Die Erde ist rund) ein Schicksal, ein durchaus wünschenswertes Schicksal. Denn sie reduziert die Unterschiede unter den Menschen und optimiert zugleich die weltweite Verteilung der Ressourcen. Ich höre schon den Einspruch jener, die nun sagen, sie optimiere auch die Ausbreitung des Virus. Tatsächlich habe ich dieser Tage gelesen, das Coronavirus präsentiere uns endlich die Rechnung für eine aus dem Ruder gelaufene Globalisierung. Nichts könnte falscher sein. Die Pest, die um die Mitte des 14. Jahrhunderts einen Drittel der europäischen Bevölkerung dahinraffte, kam genau wie das Coronavirus aus China. Entweder gab es die Globalisierung schon im 14. Jahrhundert (was natürlich in gewisser Weise immer stimmt, weil ja die Erde rund ist) – oder das Coronavirus präsentiert uns die Rechnung für genau gar nichts.
Medizin
Wenn uns das Virus beschäftigt – was durchaus richtig ist –, dann deshalb, weil wir über ein fortschrittliches Gesundheitssystem verfügen. Dieses System kann in eine Krise geraten – noch vor fünfzig Jahren hätte sich das Problem gar nicht gestellt, und wir hätten die Pandemie wie ein Schicksal ertragen. Das Virus hätte ein brutales Blutbad angerichtet, wenn auch nicht ein solches wie vor hundert Jahren die Spanische Grippe, weil das Coronavirus trotz allem viel weniger aggressiv ist. Unsere Sorgen sind also – recht bedacht – ein unwiderlegbarer Beweis für die Tatsache, dass die Menschheit sich zum Guten entwickelt, dass die Wissenschaft laufend Fortschritte macht und dass die Medizin ein Wissen ist, dem wir huldigen sollten, statt dahinter das Komplott böser multinationaler Firmen zu vermuten.
Tod
Fast hätte ich ihn vergessen. Am Virus kann man sterben, wie an so manchen anderen Dingen auch. Früher oder später sterben wir alle, was ja für unser Denken weiterhin einen Skandal darstellt. Den Tod kann man nicht denken. Aber es hat sein Gutes, dass das Coronavirus politisch korrekt ist und die Älteren, die schon länger leben, bevorzugt (ich darf das sagen, weil ich mit meinem zarten Alter von 64 Jahren selber ein ideales Opfer bin). Es heisst, Abschied sei ein bisschen wie sterben – aber sterben ist dann doch ein wenig zu viel Abschied. Hier liegt das ganze Problem. Aber man kann Schlachten überleben. Mein Grossvater jedenfalls ist später seelenruhig in seinem Bett zu Hause gestorben. Anderseits gibt es nichts Absurderes, als um jeden Preis überleben zu wollen. Ums Leben geht’s, nicht ums Überleben, daran sollten wir uns dieser Tage erinnern. Niemand sagte es so schön wie Anno Domini 1757 der preussische König Friedrich II., der Grosse, in der Schlacht bei Kolin. Er ermahnte seine Soldaten, die vor den Österreichern zurückwichen, mit den wunderbar philosophischen Worten: Ihr verfluchten Kerls, wollt ihr denn ewig leben?
