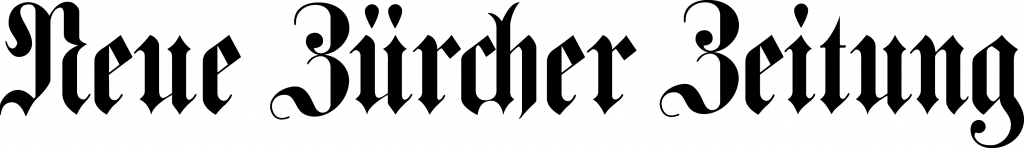- Für Menschen, die nichts sehen und nichts hören, sind Berührungen der letzte Zugang zur Welt
- Das Leben als Taubblinde? «Eigentlich permanent gefährlich»
- «Ich kaufe mir Unterstützung. Ergibt sich daraus eine Freundschaft, ist es fraglich, ob sie auch eingekauft ist»
- Einmal am Tag kommt die Spitex. Mit ihr kommunizieren kann sie nicht
- Was sind Wörter, wenn man sie weder hören noch sehen kann?
- «Man bewundert mich, aber was darüber hinausgeht, löst sich im Nichts auf»
Für Menschen, die nichts sehen und nichts hören, sind Berührungen der letzte Zugang zur Welt

Christine Müller ertastet sich mit ihrem Blindenstock den Weg. Es ist kalt, der Rand des Bahnsteigs ist leicht schneebedeckt. Der Stock und ihr rechtes Ohr, das noch nicht ganz taub ist, sind das Einzige, was ihr Orientierung gibt. Sie geht auf der rechten Seite, sucht die Leitlinien für Blinde. Dann glaubt sie, Stöckelschuhe zu hören. Sie will ausweichen, schiebt den Blindenstock zur Seite, doch da ist kein Boden mehr. Christine Müller verliert das Gleichgewicht und stürzt 1 Meter 20 tief aufs Gleis.
Ihr Kopf schmerzt, das Knie noch mehr. Christine Müller weiss nicht, ob sie jemand hat fallen sehen. Aus eigener Kraft kann sie nicht mehr aufstehen. Ob ein Zug naht, sieht sie nicht. Käme er von der linken Seite, würde sie ihn nicht hören.

Christine Müller sieht nichts und hört selbst mit einem Hörgerät kaum etwas. Sie gilt als taubblind und gehört damit zu den 57 000 Menschen in der Schweiz, die gleichzeitig mit einer Seh- als auch einer Hörbeeinträchtigung leben müssen. Nur wenige von ihnen kommen so zur Welt. Die meisten können bei der Geburt entweder nicht sehen oder nicht hören. Die andere Fähigkeit verlieren sie erst im Lauf des Lebens.
Kaum jemand weiss, dass es taubblinde Menschen gibt. Und das ist kein Zufall. Kaum jemand lebt isolierter als taubblinde Menschen. Kaum jemand lebt einsamer als taubblinde Menschen. Und vielleicht gerade deswegen hatten sie uns noch nie so viel zu sagen wie heute.
Christine Müller kommt gesund zur Welt und führt lange ein normales Leben. Bis zum Frühling 1996. Sie steht kurz vor dem Abschluss des Lehrerseminars, hat bereits eine Stelle gefunden. Dann erleidet sie eine Hirnhautentzündung.
Als sie das Spital verlässt, ist die Welt eine andere: Häuser sehen aus wie Klötze, Menschen wie Strichmännchen, und ihren Freund erkennt sie nicht mehr. Zwei Jahre später kann sie das Licht nicht mehr von der Dunkelheit unterscheiden und kaum noch hören.
Die Sorge ihrer Ärzte, die Trauer ihres Umfelds versteht sie zuerst nicht. Ihr damaliger Freund und sie sind überzeugt, dies gemeinsam durchzustehen. Lange glaubt Christine Müller an ein Wunder. Heute sagt sie: «Von heute auf morgen kam ich auf einen neuen Lebensweg, ungefragt, unbestellt. Wie in einem schlechten Film.»
Das Leben als Taubblinde? «Eigentlich permanent gefährlich»
Christine Müller tastet sich durch die Wohnung. Ihre Hände gleiten über einen Teppichstreifen den Wänden entlang. Er wurde befestigt, damit sie sich daran orientieren kann. Sie geht vorsichtig, immer bereit, anzuhalten, sollte etwas im Weg stehen. Doch es steht nichts im Weg. Die Wohnung ist karg, es stehen keine Beistelltische herum, keine Pflanzen am Boden. Als wäre sie gerade erst eingezogen.

Annick Ramp / NZZ
In der Küche brodelt das Wasser im Kocher. Christine Müller weiss, wie lange es dauert, bis es kocht. Sie stellt eine Tasse hin und füllt das Wasser ein. Blinde Menschen sehen nicht, wenn die Tasse voll ist, aber sie hören es. Und eine taubblinde Person? Christine Müller hängt einen Wasserstandsmesser über den Rand, der vibriert, wenn das Wasser ihn berührt. Doch just in diesem Moment: Vorführeffekt. Das Gerät vibriert nicht, das Wasser überläuft. Christine Müller merkt es erst, als das Wasser über die Küchenabdeckung läuft und ihre Finger verbrennt.
Vor kurzem fällt ihr eine ihrer vier Tassen zu Boden. Was ein sehender Mensch in Kürze zusammenwischt, ist für Christine Müller eine kaum vorstellbare Herausforderung: Wo sind die Scherben verteilt? Wie liest man sie auf, ohne sich daran zu schneiden? Und wie viele Tage muss man sich vor Scherben fürchten, die man nicht erwischt hat? Es kommt noch schlimmer. Als sich Christine Müller in der Eile bücken will, um die Scherben aufzuheben, schlägt sie mit dem Kopf gegen die Küchenabdeckung. «Der Schädel brummt mir heute noch», sagt sie. «Ich sollte meine Wohnung nach all den Jahren gewiss besser kennen.»
Ein anderes Mal vergisst Christine Müller, die Herdplatte auszuschalten. Sie merkt es erst, als es verbrannt riecht. Sie hat einen Putzlappen darauf liegen gelassen.
Das Leben als Taubblinde? «Eigentlich ist es permanent gefährlich», sagt Christine Müller. «Aber ich kann ja nicht jedes Mal einen Nachbarn zu Hilfe holen, wenn so etwas passiert.»
Ohnehin weiss Christine Müller nach mehreren Monaten Pandemie kaum noch, wer im Haus lebt. Mit einigen älteren Menschen pflegte sie guten Kontakt. Sie hatten Zeit, Kaffee mit ihr zu trinken. Viele von ihnen wohnen inzwischen im Altersheim. Und neue Menschen lernt sie kaum kennen. Helen Keller, eine taubblinde amerikanische Schriftstellerin, sagte einst: «Die Blindheit trennt von Dingen, die Taubheit von Menschen.»
Christine Müller führt ein Leben in Isolation. Sie weiss, was es heisst, alleine zu sein, müsste man meinen. Doch als Corona kam, fühlte sie sich, als stünde sie buchstäblich vor dem Nichts. Kein Händeschütteln, keine Umarmungen, und mit den empfohlenen zwei Metern Distanz kann sie selbst mit Hörgerät keine Stimme erkennen. In hallenden Räumen, etwa dem Treppenhaus, ist es besonders schlimm. Wer vor der Tür steht, hört sie nicht. Einkäufe, die ihr nach Hause gebracht werden, nimmt sie entgegen, ohne ihr Gegenüber zu erkennen. Zum Kaffee kommt schon lange niemand mehr.
Nun, während der Pandemie, erlebt die ganze Welt, was es bedeutet, alleine zu sein. Zumindest ein wenig. Wenn diese Zeit vorüber ist, wird Christine Müller in Isolation bleiben.

Annick Ramp / NZZ
«Ich kaufe mir Unterstützung. Ergibt sich daraus eine Freundschaft, ist es fraglich, ob sie auch eingekauft ist»
Wenn Christine Müller mit jemandem reden will, braucht sie dafür viel Hilfe. Da ist beispielsweise ihr Hörgerät für das rechte Ohr. Es ermöglicht mit einem stiftähnlichen Mikrofon ein langsames und deutliches Zweiergespräch in einer ruhigen Umgebung. Doch wegen der Hörhilfe sendet auch ihr taubes Ohr fortlaufend Signale, Töne und Geräusche «in einer Mordsgeschwindigkeit», wie Christine Müller erklärt. Sie könne es nicht lange ertragen. Nach einer Stunde Gespräch bittet sie, auf Lormen umzustellen. So nennt sich die Sprache der taubblinden Menschen: Es handelt sich um eine Art Schrift, die auf die Handfläche gezeichnet wird. Beispielsweise wird für «E» auf die Spitze des Zeigefingers getippt, für «G» wird dem Ringfinger entlanggestrichen und für «S» ein Kreis in die Mitte der Handfläche gezeichnet. Die Fragen werden also fortan übersetzt. Sie braucht dafür einen Kommunikationsassistenten, der das Lormen beherrscht. Christine Müller antwortet in breitem Grazerdialekt. Sie hat sich daran gewöhnt, dass Gespräche heute oftmals auf diese Weise stattfinden.
Christine Müller erinnert sich an den Moment, als ihr das erste Mal bewusst wurde, wie weit an den Rand der Gesellschaft sie gedrängt werden würde. Es war ein Abendessen mit einem befreundeten Paar, kurz nach ihrem Seh- und Hörverlust. Die Runde plauderte, witzelte und lachte. Nur Christine Müller sass unbeteiligt daneben. Was sie hören konnte, verschwamm zum Geräuschteppich. «Ich kam überhaupt nicht mit. Damals hatte ich noch nicht die Courage, alle immer wiederholen zu lassen.»
Der Freundeskreis verflüchtigte sich, die Beziehung hielt weitere zehn Jahre. Christine Müller versuchte in dieser Zeit, so «unbehindert wie möglich» zu werden. Ihr Freund hielt sich mit Unternehmungen zurück. «Auch dank ihm kann ich heute so selbständig leben», sagt sie. Die Trennung verlief friedlich, noch heute ist er ein enger Freund. Christine Müller lebt seither alleine. «Es gelingt. Doch ich spüre die Vereinsamung.»
Zu ihrem Umfeld zählt sie eine Begleitperson, die sie wöchentlich besucht und die sie von ihrem eigenen Geld bezahlt. Sie war Christine Müllers einziger Kontakt während des Shutdowns. Sie pflege zudem regelmässigen Austausch mit einem «Schicksalskollegen» – einem ebenfalls taubblinden Mann – und dessen Partnerin. Doch dieses Urvertrauen, das Unbeschwerte in Freundschaften, wie sie es aus unbehinderter Zeit kenne, gebe es heute nicht mehr. «Ich nenne es oftmals: ‹Liebe einkaufen›. Ich kaufe mir Unterstützung, und wenn sich daraus eine Freundschaft ergibt, so ist letztlich fraglich, ob diese nicht auch eingekauft ist.»
Christine Müller konnte das Lehrerseminar damals zwar abschliessen, doch sie fand nie ins Arbeitsleben zurück. Sie hat an viele Türen geklopft. «Überall war ich zu stark behindert.» Sie hätte gerne mit taubblinden Kindern gearbeitet, schnupperte bei einer Stiftung. Eine Stelle erhielt sie nicht. «Heute, mit 53 Jahren, weiss ich: Ich bin in den Augen der Welt untauglich. Punkt.»
Wie die meisten taubblinden Menschen lebt Christine Müller von der Invalidenversicherung und der Hilflosenentschädigung. Je nach Höhe der Beiträge reicht dies knapp zum Überleben. Für Begleitung und Kommunikationsassistenz kann ein sogenannter Assistenzbeitrag bei der IV beantragt werden. Doch oft reicht das Angebot der Leistungen bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken.
Einmal am Tag kommt die Spitex. Mit ihr kommunizieren kann sie nicht
Als Clara Clavuot acht Jahre alt war, stieg ihr Vater mit ihr in einen Zug nach Zürich. Clara kam gehörlos zur Welt, und anders als ihre drei Geschwister ging sie nicht zur Schule, sondern verbrachte ihre Tage daheim auf dem Hof in Zernez. Da ihre Eltern von einem Internat für Kinder mit Hörbeeinträchtigung in Wollishofen hörten, machte sich ihr Vater mit ihr auf den Weg. Dort angekommen, übergab er sie an einen Freund, der sie ins Internat brachte. Der Vater fuhr zurück ins Engadin.

Annick Ramp / NZZ
Clara Clavuot, heute 79 Jahre alt, hadert nicht mit ihrer Kindheit. «In Zürich war mir vieles fremd. Doch ich lernte, zu rechnen, zu lesen und zu schreiben, und fand Freunde in der Schule.» Sie hadert auch nicht mit ihrem Schicksal: Von Geburt an taub, erblindete sie im Verlauf ihres Lebens. Die zunehmende Sehschwäche sei wohl genetisch bedingt gewesen.
Clara Clavuot hat nie gehört, wie Worte tönen. Wenn sie redet, klingt es, als ob sie in einer fremden Sprache spricht. Ihr rollendes R ist ausgeprägt, dazwischen ertönen nasale, melodiöse Laute. Sie zu verstehen, braucht Übung. Wie Christine Müller braucht auch Clara Clavuot einen Kommunikationsassistenten. Die Fragen werden vereinfacht gelormt, ihre Antworten in verständlicher Sprache wiederholt. Ein Gespräch mit ihr dauert zehnmal länger als mit hörenden und sehenden Menschen.
Clara Clavuot ist eine Frau von kleiner Statur, graues, kurzes Haar. Ihre Augen kneift sie zusammen, wenn sie lächelt. Sie wohnt alleine in einer Alterssiedlung. Einmal am Tag kommt die Spitex vorbei, verabreicht ihr Medikamente. Mit ihnen kommunizieren kann sie nicht. «Dafür haben sie auch keine Zeit», sagt sie.
Was sind Wörter, wenn man sie weder hören noch sehen kann?
Die Wohnung von Clara Clavuot ist bunt geschmückt. Darauf angesprochen, strahlt sie. Sie zeigt zielsicher auf jedes Stück: Die abstrakten Elefantenbilder an der Wohnzimmerwand, die sie von einer Safari in Kenya mitgebracht hat, die Glocken hinter dem Sofa, die aus dem Berner Oberland stammen, und ein farbiges Glasbild von Zernez, das sie von ihrer Schwester erhalten hat.

Annick Ramp / NZZ
Clara Clavuot ist viel gereist. Noch vor ihrer Erblindung, da war sie 25 Jahre alt, besuchte sie Griechenland und Italien. Die Länder, die folgten, hat sie gespürt, gerochen, gefühlt. Sie war in Spanien, Russland, Finnland, den USA. Die meisten Reisen unternahm sie in Gruppen oder mit einer Begleitperson, früher mit dem Taubblindenverband oder der Taubblinden-Hilfe. Inzwischen sei das zu teuer geworden.
Clara Clavuot ist oft allein. Wer ihre Nachbarn sind, weiss sie nicht, sie wechseln häufig. Einsam fühle sie sich deswegen nicht. Zu zwei langjährigen Begleitpersonen hat sie einen engen Bezug. Zu ihren beiden noch lebenden Geschwistern pflegt sie Kontakt. Den Menschen, die ihr wichtig sind, schreibt Clara Clavuot E-Mails. Eine Tastatur mit Braillezeile übersetzt ihr sämtliche Nachrichten in die Blindenschrift. Sie wiederum tippt ihre Nachricht im Punktesystem ein, die schliesslich in Schwarzschrift an den Empfänger gesendet wird. Erhaltene Briefe lässt sie von einer Begleitperson lormen.

Annick Ramp / NZZ
Nach draussen geht Clara Clavuot selten. Allein spazieren gehen kann sie nicht. Im Haushalt kommt sie dagegen gut zurecht. Sie kocht gerne, die zahlreichen Ordner mit Rezepten in Blindenschrift zeugen davon. Und sie stickt gerne bunte Muster auf Kissenbezüge. Unternimmt sie etwas, handelt es sich meist um Angebote des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB). Seit Beginn der Pandemie hat jedoch keine einzige Veranstaltung stattgefunden. Das vermisst sie, die Ferien auch. Sonst sei «alles gut», wie sie sagt. Vieles kannte sie nie anders.
Die Einschränkungen von Clara Clavuot und Christine Müller sind ähnlich, ihre Leben unterscheiden sich dagegen sehr. Würde man fünf weitere taubblinde Menschen besuchen, zeigten sich fünf weitere, komplett andere Leben. Wie diese aussehen, hängt etwa davon ab, wie alt die Person war, als sie erblindete oder taub oder beides wurde. Konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig sprechen, ist die Person nur schwer zu verstehen, und der Wortschatz fehlt.
Das zeigt sich insbesondere bei Menschen, die bereits taubblind zur Welt kamen. Sie leben in einer Welt, die uns verschlossen bleibt. Wie denkt man, wenn man nie Worte gehört, Dinge gesehen hat? Wie versteht man seine eigenen Gefühle, wenn man sie nicht in Worte fassen kann? Und wie erst versteht man die Gefühle anderer?
Solchen Menschen steht ein jahrelanger Prozess bevor, um zu lernen, mit ihrer Umwelt zu kommunizieren, ihre Bedürfnisse auszudrücken und ihren Alltag zu bewältigen. Gespräche, wie sie mit Clara Clavuot oder Christine Müller stattfinden, werden mit ihnen aber nie möglich sein.
Ist es also schlimmer, im Laufe des Lebens zu erblinden oder sein Gehör zu verlieren – oder gar nicht erst zu kennen, was man niemals hatte?
«Man bewundert mich, aber was darüber hinausgeht, löst sich im Nichts auf»
Taubblinde Menschen mögen in ihrer eigenen Welt leben. Dennoch gibt es eine Welt draussen, der sie nicht entfliehen können. Sie sind ihr ausgeliefert.
Wenn Christine Müller über die Strasse geht, hört sie mit dem Hörgerät im besten Fall von einer Seite, ob ein Auto naht. Sie signalisiert mit ausgestrecktem Blindenstock, dass sie die Strasse überqueren will. «Und dann kommt, wie ich sage, das Gottvertrauen: Ich laufe los, in der festen Hoffnung, dass von der nicht hörbaren Seite kein Fahrzeug naht.»
Fährt sie Zug, so merkt sie sich die Anzahl Haltestellen, bis sie aussteigen muss. Mit dem ICE von St. Gallen sind es zwei Stationen bis Flawil, das weiss sie. Einmal, als es besonders laut war im Zug und sich die Geräusche im Hörgerät überschlugen, war Christine Müller unsicher, welcher Ort als Nächstes kommt. Also fragte sie, unwissend, ob jemand in der Nähe war und sie hören würde: «Ist der nächste Halt Flawil?» Sie glaubte, ein «Ja» gehört zu haben, und stieg aus. Als ihr die Abfolge der Markierungen nach einigen Metern unbekannt vorkamen, fragte sie erneut ins Nichts: «Ist das hier Flawil?» Ein Mann verneinte: «Sie sind in Gossau.» Daraufhin half er ihr, in den nächsten Zug nach Flawil zu steigen.
Hilfsbereitschaft von Fremden, das erlebe sie im Alltag oft. Rar ist hingegen, dass sich Menschen Zeit nehmen. «Ich bin überall eine Exotin. Man ist zwar interessiert an mir, man bewundert mich, aber alles, was darüber hinausgeht, löst sich irgendwann im Nichts auf.» Hadert sie manchmal mit ihrem Schicksal? Christine Müller hält inne. «Mmh. Manchmal. Dann, wenn ich mich zu sehr in die Realität des Ausgeschlossenseins begebe.» Dennoch habe das Leben sie gelehrt, Geringes zu schätzen. Selbst Frühstück zuzubereiten, zu meditieren und in sich zu gehen, während andere Feste feiern. «Weihnachten mit einer Gruppe Menschen zu verbringen, die lachen und reden, während ich wie ein Maskottchen danebensitze, ist für mich schlimmer, als allein zu Hause zu bleiben.» Schenke ihr dafür jemand Zeit, sei das unbezahlbar. Seit dem Sturz aufs Bahngleis habe sich das noch verstärkt.
In den Sekunden, als Christine Müller auf dem Bahngleis liegt, fährt kein Zug ein. Zwei junge Frauen haben ihren Sturz beobachtet. Sie helfen ihr aus dem Gleisbett heraus. Als Christine Müller wieder auf den Beinen steht, kommt ein junger Mann zu Hilfe. Er will sie ins Spital begleiten, doch sie lehnt ab. «Mein ehemaliger Freund war in den Ferien. Ich hätte ohne Begleitperson, die mit meiner Behinderung vertraut gewesen wäre, ins Spital gehen müssen. Diese Strapaze wollte ich mir ersparen.» Der Mann begleitet Christine Müller nach Hause. Sie hält die Nacht mit schmerzendem Knie und brummendem Schädel durch. Alleine, wie immer.