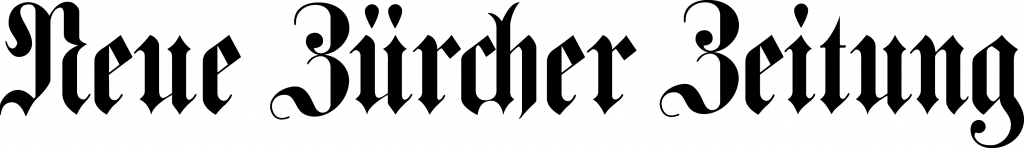«Wenn Sie tot sind, bringt Ihnen Geld nichts mehr»

Andrew Lichtenstein / Corbis News
NZZ am Sonntag: Ihr neues Buch trägt den Titel «Tod aus Verzweiflung». Sie haben damit eine breite Debatte losgetreten. Doch weshalb beschäftigen Sie sich als Ökonom mit einem solch aussergewöhnlichen Thema?
Angus Deaton: Nun ja, das ist eine gute Frage. Letztlich geht es um das menschliche Wohlbefinden. Die Ökonomen schauen dabei traditionellerweise auf das Einkommen. Obschon dies keineswegs das Gleiche ist wie das Wohlbefinden. Deshalb wollten wir das Thema aus einer breiteren Perspektive untersuchen. Ich finde, wir sollten mehr über das Leben selbst nachdenken. Denn das Leben ist wichtiger als der Besitz: Wenn Sie tot sind, bringt Ihnen Geld nichts mehr.
Aus diesem Grund haben Sie begonnen, Sterbeziffern zu studieren?
Ja, die Mortalität ist vermutlich der beste soziale Indikator, den es überhaupt gibt. Wir erfahren daraus sehr viel über den Zustand einer Wirtschaft.
Bei Ihrer Analyse haben Sie gesehen, dass die Lebenserwartung in den USA erstmals seit Jahrzehnten zurückgeht. Was sind die Ursachen?
Jedes Jahr sterben hierzulande Hunderttausende Personen wegen Alkohol, an einer Überdosis Schmerzmittel oder weil sie Selbstmord begehen. Besonders ausgeprägt ist diese Zunahme in der mittleren Altersgruppe weisser Männer. Offenbar läuft etwas komplett falsch in unserer Wirtschaft.
Was meinen Sie damit?
Seit über hundert Jahren ist die Sterblichkeit stark gefallen. Nun aber haben wir festgestellt, dass die Häufung vorzeitiger Todesfälle in den USA plötzlich wieder zunimmt. Das war der erste Faktor, der uns erstaunt hat. Zweitens haben wir die Sterbedaten danach sortiert, wie gut die Leute ausgebildet waren. Nehmen wir die Gruppe weisser Männer zwischen 45 und 54 Jahren ohne Hochschulabschluss: In dieser hat sich die Zahl der Todesfälle wegen Alkohol, Drogen oder Selbstmord innert 20 Jahren mehr als verdoppelt. Damit ist diese Todesursache dreimal so häufig wie bei gleichaltrigen Männern, die einen Hochschulabschluss besitzen.
Sie sprechen von einem «Tod aus Verzweiflung». Weshalb?

Was uns bei der Untersuchung am meisten ins Auge gestochen ist: Der Faktor Bildung führt bei einer ganzen Reihe von Indikatoren zu einem eklatanten Unterschied. Sei es beim Lohn, der Beschäftigung, der Heirat oder der allgemeinen Zufriedenheit: Stets besteht ein tiefer Graben zwischen den Menschen mit guter und schlechter Bildung.
Wird diese Spaltung wegen der Pandemie zunehmen?
Davon gehe ich aus. Der Bildungsgrad spielt auch eine grosse Rolle dabei, wie stark Menschen von der Pandemie betroffen sind. Akademiker können bequem von zu Hause aus arbeiten. Umgekehrt haben solche ohne Hochschulabschluss meistens die riskanteren Berufe, und sie verlieren häufiger den Job.
Woher kommt diese wachsende Verzweiflung, die Sie in der Schicht der weniger Gebildeten diagnostiziert haben?
In unserer Gesellschaft ist das Prinzip der Meritokratie stark verwurzelt. Es ist das Versprechen, dass jeder durch eigene Leistung zum Erfolg kommen kann. Dieses Prinzip hat aber eine Kehrseite: Wer nämlich erfolglos bleibt im Leben, muss den Grund bei den eigenen Fehlern suchen – selbst wenn er alles richtig gemacht hat. Umgekehrt können die Gewinner sagen, der Erfolg sei der Lohn für ihre Tugenden. Obwohl sie vielleicht einfach mehr Glück hatten als andere. Das Resultat ist eine zunehmende Verbitterung unter jenen, die auf den unteren Stufen in dieser Rangliste stehengeblieben sind. Ohne Hochschulabschluss ist es in den USA fast unmöglich geworden, eine sichere Arbeit und soziales Ansehen zu erhalten. Hier geht es nicht nur ums Geld, sondern mindestens so sehr um das Selbstwertgefühl und die Würde.
Das klingt, als wäre ein neuer Klassenkampf ausgebrochen.
Wir erleben in der Tat einen neuen Klassenkampf. Schauen Sie nur, wie viele Stimmen Donald Trump bekommen hat. Viele dieser Wähler verspüren eine grosse Wut. Diese richtet sich insbesondere gegen Personen aus der gebildeten Elite, wie zum Beispiel Hillary Clinton.
Hat die Globalisierung diese Entwicklung herbeigeführt?
Die Globalisierung sowie der Siegeszug der Roboter haben das Leben für Menschen mit wenig Bildung um einiges schwieriger gemacht. Hinzu kommt in den USA, dass die sozialen Netze sehr schwach entwickelt sind. Ausserdem hat unser Land ein enorm teures Gesundheitssystem. Das belastet ebenfalls primär die unteren Schichten. Eine Familie bezahlt für ihre Krankenkasse rund 20 000 $ im Jahr. Wer als Coiffeuse oder Verkäufer 30 000 $ verdient, kommt finanziell rasch an seine Grenzen.
Sollten wir die Globalisierung bremsen, wenn diese die sozialen Gegensätze verstärkt?
Es wäre falsch, die Globalisierung zum alleinigen Sündenbock zu stempeln. Denn es gibt durchaus Länder, die besser damit umgehen können, zum Beispiel die Schweiz oder Deutschland. Das liegt auch am Steuersystem: So hat die Mehrwertsteuer in Europa eine wichtige Funktion zur Finanzierung der staatlichen Ausgaben. Das ermöglicht ein viel leistungsfähigeres soziales Sicherheitsnetz als in Amerika.
Sie sind überzeugt, dass die USA die Steuern erhöhen sollten?
Unter der Regierung von Donald Trump kam es zu einer massiven Reduktion der Steuersätze. Insbesondere die grossen Konzerne erhalten zu viele Steuergeschenke. Das sollten wir ändern. Denn die soziale Ungleichheit ist ein riesiges Problem hierzulande, welches von den Politikern noch zu wenig wahrgenommen wird.
Auf der anderen Seite haben die USA enorm erfolgreiche Konzerne wie Amazon, Microsoft, Google oder jüngst Tesla hervorgebracht. Solche Firmen fehlen in Europa.
Der Kapitalismus erzeugt eine kreative Zerstörung: Im besten Fall kann dies einen enormen Wohlstand und Fortschritt generieren, von dem letztlich die gesamte Gesellschaft profitiert. So ziehen wir alle einen grossen Nutzen aus den Erfindungen von Google, Netflix oder Apple. Diese kreative Zerstörung hat aber ebenso gewichtige Nachteile: Wer früher auf der Gewinnerseite stand, gehört heute plötzlich zu den Verlierern.
Somit gelingt es zu wenig, den Fortschritt der Allgemeinheit zugänglich zu machen?
Die grossen Techfirmen sind ein gutes Beispiel: Google wurde ursprünglich von einer Gruppe junger Idealisten gegründet. Dazu passte ihr damaliges Motto «Don’t be evil» («Sei nicht böse»). Heute jedoch ist der Konzern dermassen dominant, dass er von den Staaten eingeklagt wird, weil er womöglich seine Monopolstellung missbraucht. Daher müssen wir versuchen, den Prozess der kreativen Zerstörung in der Wirtschaft besser unter Kontrolle zu bringen.
«Es muss uns gelingen, dieses Biest besser zu zähmen.»
Der Titel Ihres Buchs lautet in voller Länge: «Tod aus Verzweiflung und die Zukunft des Kapitalismus». Sprechen wir also über den zweiten Teil: Wie lösen wir die erwähnten Probleme?
Zunächst einmal: Anne Case, mit der ich das Buch geschrieben habe, und ich sind klar für den Kapitalismus. Jede Form von Sozialismus ist für uns die schlechtere Alternative. Denn die Kräfte des Marktes haben enorme Vorteile: Sie haben die Armut auf der Welt stark verringert und vielen Menschen zu Wohlstand verholfen. Doch für eine breite Schicht der Bevölkerung in den USA funktioniert der Kapitalismus derzeit nicht richtig. Es muss uns gelingen, dieses Biest besser zu zähmen.
Was schlagen Sie konkret vor?
Wir brauchen ein griffiges Kartellgesetz, um die Dominanz der Grosskonzerne einzuschränken. Ausserdem müssen die USA das Gesundheitssystem reformieren. Es ist unsinnig zu glauben, dass dies über den freien Markt funktioniert. Allein dies sind zwei grosse, enorm komplexe Bereiche, in denen wir uns stärker am Modell der Europäer orientieren sollten. Das bringt mich zurück auf den Aspekt des Wohlbefindens zu Beginn unseres Gesprächs: Dass wir gratis Facebook nutzen können, ist sicherlich toll. Doch wer frühzeitig stirbt, hat keinen Nutzen daraus.
Sie kritisieren das Gesundheitswesen der USA: Was läuft falsch?
Der Gesundheitssektor in den USA ist der teuerste der Welt. Trotzdem haben die Länder in Europa eine deutlich höhere Lebenserwartung als die Amerikaner. Zur Schweiz beträgt die Differenz ganze fünf Jahre. Zudem: Würde unser Land nur schon auf das Kostenniveau der Schweiz fallen, so könnten wir 1000 Mrd. Dollar einsparen. Das ist mehr als unser Budget für das Militär.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Amerika müsse wieder gerechter werden. Was meinen Sie damit?
Die Diskriminierung von Minderheiten ist zwar ein wichtiges Thema in unserem Land. Doch die Benachteiligung der Ungebildeten wird dabei meistens ausgeklammert. Kaum jemand stört sich zum Beispiel am beleidigenden Begriff «Redneck». (Anmerkung: Das Wort beschreibt Leute, die durch die Arbeit im Freien einen geröteten Nacken bekommen. Meistens wird es abwertend im Sinn von Prolet oder Hinterwäldler benutzt.)
Worauf führen Sie das zurück?
Wir sind uns viel zu wenig bewusst, dass die Ausbildung und die berufliche Karriere nicht nur vom eigenen Fleiss abhängen. Die allermeisten Leute arbeiten hart in ihrem Leben. Doch wie weit wir damit kommen, ist zu einem grossen Teil durch Zufälle bestimmt. Dieses Bewusstsein ist vielerorts verloren gegangen.
Mit Ihrer Analyse halten Sie der Gesellschaft einen sehr kritischen Spiegel vor. Sehen Sie die Lage nicht etwas gar pessimistisch?
Wir haben sicherlich einen Nerv getroffen. Bereits unsere erste Studie zu diesem Thema hat einen riesigen Sturm in der Öffentlichkeit ausgelöst – mehrheitlich allerdings mit positiven Reaktionen. Das Echo war sogar grösser als bei meiner Verleihung des Nobelpreises. Auch der Begriff «Tod aus Verzweiflung» aus unserem jüngsten Buch hat sich in Kürze zu einer stehenden Wendung entwickelt.
Worauf führen Sie dieses enorme Interesse zurück?
Ich sehe viele Parallelen zur Debatte über die Ungleichheit bei den Vermögen. Wir wussten, dass die Divergenz zunimmt. Aber erst als Thomas Piketty anhand der Steuerdaten belegen konnte, wie stark die Vermögen der 1% Reichsten effektiv zulegten, entstand daraus eine breite Diskussion. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir nun beim Thema der Sterblichkeit. Auch hier werden die Gegensätze in der Gesellschaft immer grösser.

Angus Deaton – Professor der Universität Princeton
Der 75 Jahre alte Deaton gehört zu den einflussreichsten Ökonomen. 2015 erhielt er den Nobelpreis. Sein neustes Buch «Deaths of Despair» («Tod aus Verzweiflung») hat er zusammen mit seiner Gattin, der Ökonomin Anne Case, verfasst. Darin haben sie dokumentiert, dass bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie in den USA ein sinkender Trend bei der Lebenserwartung eingesetzt hat. Und zwar primär bei der Gruppe mit geringer Bildung.
Angus Deaton ist kürzlich am Forum des UBS Center for Economics in Society der Universität Zürich zum Thema Ungleichheit aufgetreten. Sämtliche Referate sind online abrufbar.