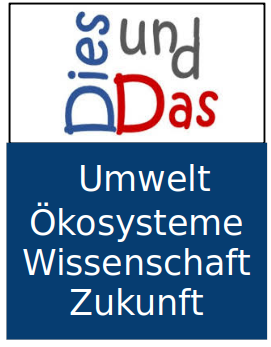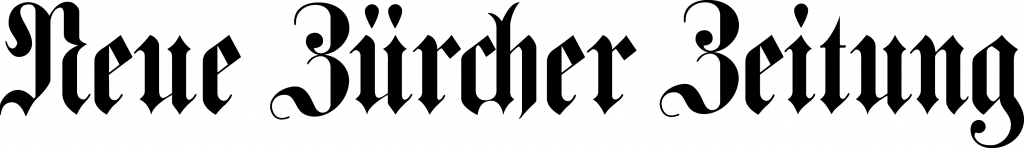- Die Filmindustrie ersetzt die einbrechende Landwirtschaft: In Jakutien zerstört der Temperaturanstieg die Lebensgrundlagen
- Rasante Erwärmung
- Der Boden rebelliert
- Ignorierte Gefahr
- Verstehen, was geschieht
- Schonung – aber keine Rettung
- Das passive Prinzip
- Filmemachen als neue Perspektive
- Ein Wald aus steinernen Säulen
- Zu diesem Thema:
- Die Zukunft entscheidet sich auf dem Land
Die Filmindustrie ersetzt die einbrechende Landwirtschaft: In Jakutien zerstört der Temperaturanstieg die Lebensgrundlagen

Mitte Februar komme ich in Jakutsk an. Die Trottoirs sind dicht bevölkert, mit –30 Grad Celsius herrscht eine Kälte, die man hier noch als freundlich empfindet. Erst wenn das Thermometer unter –40 Grad fällt, verkriechen sich die Menschen in ihre Häuser. Aufs Smartphone schaut praktisch niemand – die Kälte leert die Batterien im Nu. Die Kühlergitter der Autos sind mit Isolationsmaterial bedeckt, um den Motor zu schützen.
Auf dem Fischmarkt ist nichts zu riechen: Der Fang aus dem nahen Fluss, steif gefroren, steckt wie Baguettes in Körben oder wird zu kleinen Haufen geschichtet. Die Sonne strahlt hell, wie man es in diesem trockenen, fast arktischen Klima häufig sieht – bis die Temperatur sinkt und die Stadt sich in den für diese Region typischen, mystischen Eisnebel hüllt.
Jakutsk ist die Hauptstadt der zentralsibirischen Teilrepublik Sacha, die zu Sowjetzeiten auch offiziell Jakutien genannt wurde. Flächenmässig fünfmal grösser als Frankreich, beherbergt sie weniger als eine Million Einwohner, die unterschiedlichen Kulturen und Sprachgruppen angehören. Auf den Strassen hört man Jakutisch, Ewenisch und Ewenkisch, aber auch Russisch, die allen gemeinsame Sprache. Die Jakuten stellen mit rund 50 Prozent den grössten Bevölkerungsanteil.
Etwa 300 000 Menschen leben in der Hauptstadt; mehrheitlich auf Permafrost erbaut, liegt sie am westlichen Ufer des Flusses Lena. Von Moskau ist Jakutsk einen Nachtflug entfernt, faktisch liegt es aber näher bei Seoul – von dort fliegt man nur vier Stunden, und die beiden Städte befinden sich in derselben Zeitzone.
Rasante Erwärmung
Die Kälte ist ein ideales Thema, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Die Einwohner erinnern sich an extreme Kältephasen, in denen –50 Grad gemessen wurden; sie sind spürbar kürzer und seltener geworden. Dafür kann die Temperatur im Sommer 30 Grad und mehr erreichen. Die Durchschnittstemperatur in Jakutsk ist seit den 1970er Jahren um rund 3 Grad Celsius gestiegen. In den polaren und subpolaren Regionen schreitet die Erderwärmung rascher voran als irgendwo sonst. Eine solche Entwicklung sahen die Klimaforscher voraus, allerdings hatten sie das Tempo unterschätzt: In manchen Regionen hat sich die Durchschnittstemperatur bereits um 5 Grad erhöht.

Die schnelle Erwärmung führt zur Destabilisierung des gefrorenen Bodens und auch zu mehr Niederschlag, und beides setzt dem Permafrost hart zu. Mit Permafrost bezeichnet man Böden, die während mehr als zweier aufeinanderfolgender Jahre gefroren bleiben, aber ein Grossteil des Permafrosts ist seit Jahrtausenden nie aufgetaut. Sein russischer Name bedeutet «ewiger Frost», die Wissenschaft allerdings verwendet heute häufiger «Mehrjahresfrost». Er bedeckt beinahe ein Viertel des Festlands in der nördlichen Hemisphäre: 50 Prozent von Kanada, 60 Prozent von Russland und 85 Prozent von Alaska.
In der Region um Jakutsk zeitigt das Auftauen des Permafrosts besonders drastische Folgen. Ich bin hierhergekommen, um mich über die Forschung vor Ort und die Pläne für Notfallszenarien zu informieren, die derzeit entwickelt werden. Jakutsk ist die inoffizielle Hauptstadt der Permafrostforschung, auch das Melnikow-Permafrost-Institut ist hier beheimatet.
Der Boden rebelliert
Der Permafrost kann hier bis zu 1500 Meter in die Tiefe reichen. Man nennt ihn Yedoma – dies ist eine bestimmte Art von Permafrost, die sich aus organischer Materie und einem hohen Anteil an Eis zusammensetzt und die demzufolge sehr schnell auftauen kann.
Allerdings sagt das schlichte Wort auftauen wenig aus über die Komplexität des invasiven Prozesses, der unter der Erdoberfläche stattfindet und die ganze Topografie zerstören kann. Eher deutet der wissenschaftliche Begriff Thermokarst auf die manchmal schockierenden Veränderungen hin, die das Tauen des Permafrosts nach sich zieht. Der Boden in solchen Regionen bricht ein, sinkt ab, rutscht, bildet Krater oder kleine Hügel; breite Landstriche werden überschwemmt. Böden, Vegetation, Ökosysteme und mit ihnen die Landwirtschaft nehmen dabei Schaden, ebenso Gebäude und Infrastrukturen; ganze Regionen werden unbewohnbar, sind nicht mehr nutzbar oder sogar unzugänglich.
Eines der weltweit extremsten Beispiele für eine solche Entwicklung ist der Batagaika-Megaslump, der sich 700 Kilometer nördlich von Jakutsk nahe der Kleinstadt Batagai gebildet hat. Rund 80 Meter tief, hat er derzeit einen Durchmesser von knapp einem Kilometer, aber er wächst ständig und zieht dabei den angrenzenden Wald in seinen Krater. Der Megaslump ist eine wichtige Fundstätte für Paläontologen: Hier forscht etwa das Team des Lazarew-Mammutmuseums, das der Universität in Jakutsk angeschlossen ist. Im Sommer, erzählen die Wissenschafter, könnten sie am Grund des Kraters das tauende Eis im Boden krachen hören.
Man nimmt an, dass sich die Vertiefung Anfang der 1970er Jahre infolge von Rodungen zu bilden begann – erneut eine menschliche Intervention, die den Thermokarst auslöste oder beschleunigte; mit dem Temperaturanstieg nach der Jahrtausendwende wurde das Wachstum des Kraters exponentiell. Einstweilen ist der Batagaika-Megaslump einzigartig, aber man rechnet damit, dass sich in der Taiga weitere derartige Krater bilden werden.
Im Jahr 2050 werden vier Millionen Menschen von den Folgen des Thermokarsts betroffen sein, das sind drei Viertel der Bevölkerung in der nördlichen Permafrostzone; die Schäden an der Infrastruktur erreichen ein ähnliches Ausmass. Eine technische Lösung, die das Auftauen des Permafrosts aufhalten könnte, existiert nicht. Ende dieses Jahrhunderts wird sich ein grosser Teil dieser Landschaften in Feuchtgebiete verwandelt haben, andere Regionen werden vom Meer bedeckt sein, eine neue Küstenlinie wird sich herausbilden. Umsiedlungen und Evakuationen dürften schon in naher Zukunft unvermeidlich werden.
Ignorierte Gefahr
Diese bedrohliche Auswirkung des Klimawandels figuriert bis heute höchstens am Rand des öffentlichen Bewusstseins. Sie betrifft weitgehend isolierte Regionen und ist weder von Satelliten noch mit Fernerkundungsinstrumenten wahrnehmbar. In der Klimadiskussion kam der Permafrost immer an vierter Stelle – nach dem Schwund von Polareis, Schnee und Gletschern. Die Apokalypse, die sich in Jakutien und anderen Regionen auf dem Erdboden abspielt, stand im Schatten der Erkenntnisse über die möglicherweise verheerenden Folgen von Methanemissionen.
Allerdings sollte der Gedanke an den in Permafrostböden gebundenen Kohlenstoff nicht weniger Sorge bereiten. Der Permafrost in den arktischen und borealen Zonen enthält zwischen 1460 und 1600 Gigatonnen Kohlenstoff – fast das Doppelte dessen, was sich heute in der Atmosphäre befindet. Das Wort Kohlenstoff bezeichnet hier sowohl seit langem eingelagertes Methan als auch das «neue» Methan und Kohlendioxid, das durch die Aktivität von Mikroben in der auftauenden organischen Materie freigesetzt wird.
Diese Emissionen werden sich in einem klimabedingten Kreislauf niederschlagen oder tun dies bereits: Je wärmer es wird, desto mehr Kohlenstoff setzt der Permafrost frei; je mehr Kohlenstoff austritt, desto schneller erwärmt sich das Klima. Dieser Prozess wurde beim Pariser Klimaabkommen von 2015 ausser acht gelassen, obwohl das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) schon in seinem ersten, 1990 veröffentlichten Bericht davor gewarnt hatte.


Mammut-Museum der staatlichen Universität Nordost
Es ist äusserst schwierig, ein Modell für die beim Auftauen des Permafrosts mitwirkenden Faktoren und die Auswirkungen aufs Weltklima zu erstellen; aber kaum jemand wird bestreiten, dass der aus dem Permafrost freigesetzte Kohlenstoff die Klimaveränderungen weit über jeden «sicheren» Wert hinaustreiben könnte. Die Geopolitik in der Arktis beschränkt sich jedoch stur auf Machtinteressen und wirtschaftliche «Chancen», die sich infolge der Erderwärmung ergeben: neue Schiffsrouten, die Ausbeutung von Bodenschätzen und fossilen Energieträgern.
Verstehen, was geschieht
Ich bin unterwegs zum Melnikow-Permafrost-Institut, wo mich sein stellvertretender Leiter, Professor Alexander Fjodorow, erwartet. Vor dem dreistöckigen klassizistischen Bau im südlichen Teil von Jakutsk steht die Plastik eines Wollhaarmammuts, im Inneren reihen sich Topfpflanzen, ein unterirdischer Tunnel dient als Labor, wo der Permafrost direkt vor Ort untersucht werden kann.
In seinem kleinen, hellen Büro erschliesst mir Fjodorow sein mehr als zehn Jahre übergreifendes Archiv; es enthält erschreckende Bilder von den Schäden, die der Thermokarst an Ackerland, Weidegründen, Bauerndörfern, Gebäuden, Infrastrukturen und Naturgebieten in Zentraljakutien angerichtet hat.
Zusammen mit dem jungen Forscher und Drohnenpiloten Nikolai Bascharin betreibt Fjodorow jeden Sommer Feldforschung in den Landwirtschaftsgebieten Zentraljakutiens. Derzeit arbeiten sie an einem Projekt, das mittels Fernerkundung eine Schätzung des Anteils landwirtschaftlicher Flächen ermöglichen soll, die nicht mehr nutzbar sind. Fjodorows Team arbeitet mit einem mageren Budget und umso entschlossener: Das Auftauen des Permafrosts lässt sich nicht aufhalten, aber die Wissenschafter versuchen, den Prozess zu verstehen, seine Folgen abzusehen, Anpassungsstrategien und vielleicht sogar entsprechende Gesetze zu entwickeln.
Zentraljakutien ist weltweit die einzige Permafrostregion, in der seit den 1960er Jahren industrieller Ackerbau betrieben wird. Die durch die intensive Nutzung bedingte Verdichtung des Bodens und der Schwund organischer Materie in der obersten Erdschicht machen die Landwirtschaftsgebiete besonders anfällig für Thermokarst. Ein Hauptproblem ist das Absinken des Erdbodens und die Bildung von Hügeln, die eine Höhe von 2 Metern und bis zu 15 Meter Durchmesser erreichen können. In einer solchen Hügellandschaft ist der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen unmöglich, und der Boden kann nicht mehr genutzt werden.
Für eine grosse Zahl von Menschen in Jakutien ist ihre Identität jedoch nach wie vor stark mit der Landschaft verbunden – mit Traditionen, Territorien und fernab der Städte lebenden indigenen Gemeinschaften. Viele pflegen noch das tägliche Ritual, bei dem sie den Wald, die Tiere und ihre Geister anrufen. Das «Olonkho» genannte jakutische Heldenepos gehört zum Unesco-Welterbe.
Fjodorow bemüht sich deshalb nach Kräften, die Lebensqualität in den Dörfern zu verbessern und Mittel zu finden, um den Zeitpunkt der Umsiedlung hinauszuschieben. Er empfiehlt den betroffenen Ortschaften den Bau von Drainagesystemen, die das aus dem tauenden Erdreich aufsteigende Wasser abführen, bevor es im Winter wieder gefriert und weitere Verwerfungen des Bodens verursacht.
Ebenso befürwortet er eine Wiederaufforstung der unbrauchbar gewordenen Felder und Weidegründe sowie abgebrannter Waldgebiete oder der Freiräume in Siedlungen und ihrer Umgebung: Das ergäbe eine Art thermische Pufferzone über noch einigermassen intaktem Permafrost. Aber mit diesem Konzept riskiert man zugleich, die spärlichen Nährstoffe des Bodens zu plündern; zudem können auch ausgewachsene Wälder oft den Thermokarst nicht verhindern.
Schonung – aber keine Rettung
Die Hoffnung, die Auswirkungen der gefährlichen Entwicklung wenigstens zu mildern, ist beschränkt. So entwickelt man auch schon Programme für eine endgültige Anpassung an die neuen Umstände – was einen teilweisen Rückzug der menschlichen Zivilisation aus Jakutien und anderen Permafrostgebieten bedeuten würde.
Nicht zuletzt dank Fjodorows Insistieren wurde im Mai 2018 ein regionales Gesetz zum längstmöglichen Schutz des Permafrosts verabschiedet. Es sieht eine neue Zonenordnung vor, wobei Gebiete markiert werden sollen, in denen das Errichten neuer Gebäude oder Siedlungen sowie Landwirtschaft und andere Formen intensiver Landnutzung gänzlich zu vermeiden sind, weil sonst der durch den Temperaturanstieg beschleunigte Thermokarst noch schneller voranschritte.
Dieses Gesetz kündet eine Zeitenwende an, die im Zeichen der Deindustrialisierung und neuer Siedlungsformen in dieser fragilen, beinahe arktischen Landschaft steht. Es stellt weltweit einen wichtigen Präzedenzfall dar, doch weder kann es mit dem schnell um sich greifenden Thermokarst Schritt halten, noch hilft es den Bevölkerungsgruppen und den Landschaften, die bereits Schäden erlitten haben. Menschen, deren Häuser nicht mehr bewohnbar sind, siedeln sich häufig in derselben Gegend an, manchmal nur wenige Meter von Böden entfernt, wo sich bereits neue Hügel herausbilden.
Wenn man das Ausmass der Zerstörung in Jakutien von nahem betrachtet, dann verabschiedet man sich umgehend von der vor hundert Jahren entwickelten Phantasie, die Region dereinst nach dem Ende des Permafrosts weiträumig zu bewirtschaften. Aber eine techno-optimistische und politische Version dieses Traums – die Vorstellung, dass die Permafrostterritorien reibungslos die Funktion derjenigen Agrargebiete übernehmen könnten, die infolge der Erderwärmung nicht mehr nutzbar sind – hat sich bis heute gehalten.
Faktisch aber wird ein Grossteil dieses Landes unter Wasser stehen oder nicht mehr zugänglich sein. Sogar wenn die vom Thermokarst geschädigten Gebiete hinsichtlich der Temperatur für den Ackerbau nutzbar wären, würde es Jahrzehnte dauern, bis sich die Böden erholt haben und wieder fruchtbar sind. Und Versuche, sie zu bebauen, würden wahrscheinlich noch mehr im Boden eingelagerten Kohlenstoff freisetzen.
Das passive Prinzip
Verglichen mit anderen sibirischen Städten, die in der Sowjetzeit Zentren der regionalen Entwicklung waren, ist Jakutsk eher klein. Es besteht aus Nestern niedriger Holzhäuser, Wohnblocksiedlungen aus der sowjetischen Ära, dazwischen verstreut finden sich schicke moderne Bauten – Hotels, Einkaufszentren, Büro- und Apartmenthäuser; am Ufer der Lena sind zwei neue Quartiere im Entstehen. Sie werden auf Schwemmsand errichtet, der stabiler ist als Permafrost; diese Bauweise könnte Teil einer längerfristigen technischen Lösung sein. Das Parkhaus ist von einer dicken Isolierschicht umhüllt.
Der Permafrost unter Jakutsk reicht durchgängig vom Bodenniveau bis in 200 Meter Tiefe. Die meisten modernen Bauten stehen auf Betonpfeilern ein bis zwei Meter über dem Boden. Dies ist das sogenannte passive Prinzip des Fundamentbaus, das der Ingenieur Michail Kim 1956 eigens für das Bauen auf Permafrost entwickelt hatte, und das den Städtebau in der russischen Arktis vereinfacht.

Janna Bystrykh
Kim griff dabei eine schon früher in ländlichen Gegenden praktizierte Methode auf. Dort werden die Häuser in der Regel auf einem Rahmenwerk aus Holzblöcken errichtet, das als Thermalbarriere zwischen dem warmen Haus und dem gefrorenen Boden dient. Prioritär ist dabei nicht das Bemühen, den Bau vor dem Eindringen der Kälte zu schützen, sondern vielmehr der Schutz des darunterliegenden Permafrosts vor der Wärme, die das Gebäude abgibt.
Stünden städtische Bauten direkt auf dem Boden, dann könnten sie einen lokalen Tauprozess und damit eine Destabilisierung des Terrains auslösen, die sie irgendwann zum Einsturz brächte. In einem der Neubauprojekte probiert man deshalb Fundamente mit aktiver Kühlfunktion aus, die das Auftauen des Bodens verhindern sollen. Aber diese Einrichtung bedarf ständiger Überwachung und Wartung und ist deshalb auf lange Sicht sehr unsicher.
Dank dem passiven Prinzip sind die durch Thermokarst verursachten Schäden an den Häusern in Jakutsk bis anhin vergleichsweise geringfügig. Aber wissenschaftliche Hochrechnungen sagen voraus, dass die zunehmende Erwärmung die Stadt in zwanzig Jahren an einen kritischen Punkt bringen könnte. So wird es neben radikal neuen Techniken im Bau- und Ingenieurwesen auch realistische Pläne für eine Umsiedlung brauchen.
Filmemachen als neue Perspektive
In den Strassen von Jakutsk sieht man Kinoplakate und -reklamen auf Schritt und Tritt. Seit den 1990er Jahren ist hier eine blühende Filmindustrie entstanden; vom Schreiben der Drehbücher über die Dreharbeiten bis zur Produktion passiert alles vor Ort, oft werden die Filme in jakutischer Sprache gedreht und dann ins Russische und ins Englische übersetzt. Auch internationale Filmfestivals sind darauf aufmerksam geworden, und Filme aus Jakutien ernten von Jahr zu Jahr mehr Preise.
Mit seinen langen Wintern, den isolierten, inmitten einer weitgehend unberührten Wildnis liegenden Städten und Dörfern, mit dem rasanten Klimawandel, der monströsen, Unheil verheissenden Transformation der Landschaft, mit seinem Schatz von Legenden und mündlich überlieferten Geschichten ist Jakutien ein inspirierendes Umfeld für Filmschaffende. Diese neue Branche könnte zu einem wichtigen kulturellen und wirtschaftlichen Ersatz für die bedrängte Landwirtschaft, die Fischerei und andere regionale Gewerbe werden – zu einer Raison d’être, einem Grund, trotz den immer schwierigeren Lebensumständen hier zu bleiben.
Die endlos weite Landschaft spielt in der Regel eine zentrale Rolle in den Filmen. Sie verleiht jedem Genre zusätzliche Ausdruckskraft: der alten Legende wie dem häuslichen Drama, dem Zombie-Streifen und dem apokalyptischen Szenario ebenso wie der Liebesromanze. Die Budgets sind bescheiden, Laienschauspieler sind die Stars; Sachafilm, eine der grössten Produktionsfirmen, unterstützt das wachsende Netzwerk der unabhängigen Filmschaffenden nach Kräften, indem das Unternehmen ihnen Ausrüstungen zur Verfügung stellt und ihre Filme in den Kinos vorführen lässt.
Ein Wald aus steinernen Säulen
Nur wenige Strassen führen aus Jakutsk heraus. Eine Eisenbahnlinie ist in Planung, doch soll sie am anderen Ufer der Lena gebaut werden. Dort verläuft auch die Fernstrasse, eine Brücke gibt es nicht. Im Winter dient der zugefrorene Fluss als Strasse, Autos und Lastwagen jeder Grössenordnung überqueren ihn, um die Städte und Felder auf der anderen Seite zu erreichen.
Bei Jakutsk ist die Lena etwa zehn Kilometer breit und voll langsam wachsender Inseln aus Schwemmsand, die als Weiden genutzt werden. Wildpferde streifen am Ufer entlang und über die Inseln, Kühe trotten über endlos weite Felder. Zäune gibt es hier nicht. Wir passieren eine rund ums Jahr bewohnte Insel – eine kleine ländliche Siedlung wie so viele hier, aber auf sichererem Grund gebaut, denn mitten im Fluss gibt es keinen Permafrost. Strom haben die Bewohner allerdings nur im Winter, wenn die Leitungen mithilfe mobiler, auf dem vereisten Fluss aufgestellter Pfosten bis zur Insel geführt werden können.
Fährt man etwa 120 Kilometer weit am Ufer entlang durch die endlose Ebene, dann kommt man zu den Lena-Säulen. Sie zählen seit 2012 zum Unesco-Weltnaturerbe und sind ein beliebtes Ausflugsziel für die Bewohner von Jakutsk. Zahllose Autos sind ordentlich auf dem zugefrorenen Fluss abgestellt, der als Parkplatz dient, an Ständen bieten Verkäufer, tagein, tagaus dem schneidenden Wind ausgesetzt, heissen Tee und Sandwichs mit grilliertem Fleisch an.
Die Lena-Säulen entstanden vor etwa 400 000 Jahren durch eine andere Art von Verkarstung, bei der das kambrische Kalksteinplateau sich in eine 40 Kilometer lange Kette aus Tausenden von Säulen aufspaltete, deren schlanke Spitzen bis zu 200 Meter in die Höhe ragen. Sie sind das Relikt einer unfassbar gewaltigen Transformation der Landschaft.

Janna Bystrykh
Der Weg dorthin führt durch dichte Wälder, an Strassenschildern vorbei, die vor Bären warnen, bis auf den Rücken des Kliffs. Von dort aus blickt man über die Permafrost-Taiga, die sich in alle Himmelsrichtungen erstreckt, scheinbar endlos, aber nicht mehr «ewig». Die Landschaft, wie man sie seit Jahrtausenden kannte, und die herkömmlichen Arten, in der weiten Wildnis zu überleben, werden irgendwann verschwunden sein. Die Menschen kämpfen darum, bleiben zu können, doch die Zivilisation ist im Rückzug begriffen; dabei werden – neben dem Kohlenstoff – auch alt-neue Energien freigesetzt, aus denen neue Mythen und Geschichten entstehen.
Zu diesem Thema:
Zu diesem Thema: http://sbvelden.at/?s=permafrost
Google-Suche: https://www.google.de/search?q=„permafrost“&cad=h
Die Architektin Janna Bystrykh führt in Rotterdam eine eigene Agentur für Forschung und Design. Sie war massgeblich an der Ausstellung «Countryside. The Future» beteiligt und leitete als Mitarbeiterin von AMO/OMA bis 2018 unter anderem die Transformationen des Museums der Kleinen Eremitage in St. Petersburg und des Tretjakow-Museums in Moskau. Der obige Text aus der Publikation «Countryside. A Report» erscheint hier in leicht gekürzter Fassung. – Aus dem Englischen von as.
Die Zukunft entscheidet sich auf dem Land
Janna Bystrykhs Untersuchungen führten zu einem zentralen Kapitel in der Ausstellung «Countryside: The Future» im Guggenheim-Museum in New York, über welche die NZZ berichtete, wie auch zu einem Kapitel in der Begleitpublikation «Countryside, A Report» von AMO und Rem Koolhaas (Taschen-Verlag, Köln 2020, 352 S., Fr. 27.–).
Die New Yorker Ausstellung musste kurz nach der Eröffnung im Februar 2020 schliessen und empfängt seit der Aufhebung des Lockdowns noch bis zum 15. Februar 2021 eine begrenzte Zahl an Besuchern. Weitere Stationen in Europa und Asien sind in Planung.