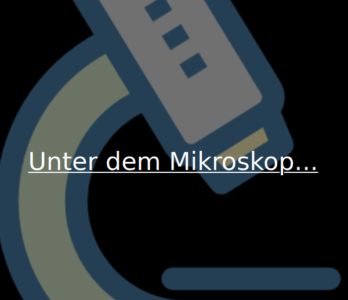- Die wichtigste Lehre aus dem Debakel in Afghanistan: Der Westen kann die Welt nicht retten
- Der Westen hat viel Geld, aber wenig Ausdauer
- Mal geht es um Werte, mal um Macht
- Weniger Enthusiasmus, mehr Realismus
- 2011 und 2012 waren die Kosten jeweils am höchsten
Die wichtigste Lehre aus dem Debakel in Afghanistan: Der Westen kann die Welt nicht retten

Nikola Solic / Reuters
Wer erinnert sich noch an Gerald Ford? In seine Amtszeit als amerikanischer Präsident fiel der schmähliche Abzug aus Vietnam. Das Bild des Helikopters auf dem Dach der US-Botschaft in Saigon hat sich in das Gedächtnis eingebrannt. So sieht es aus, wenn eine Weltmacht einen Krieg verliert. Sie stiehlt sich fort wie ein Dieb in der Nacht.
Geschichte wiederholt sich nicht als Farce, sondern als blutiger Ernst. Mit dem Namen Joe Bidens wird sich dauerhaft die Niederlage in Afghanistan verbinden. Zwar hat schon Donald Trump den Prozess eingeleitet, doch es war der Nachfolger, der den Befehl zum Abzug gab. Dieser vollzog sich dann so überstürzt und konfus, dass den Taliban das Land wie eine überreife Frucht in den Schoss fiel. Wieder ist die Weltmacht getürmt.
In den Annalen des Weissen Hauses ist Ford eine Fussnote. Eine zweite Amtszeit blieb ihm, dem Lückenbüsser nach Nixon und Watergate, verwehrt. Wie wird sich die Welt an Joe Biden erinnern? Selten hat eine Präsidentschaft mit einer so krachenden und vor allem selbstverschuldeten Katastrophe begonnen wie die des Demokraten. Zu allen Zeiten gibt es Staatsmänner, die den Umbrüchen ihrer Epoche nicht gewachsen sind. Saigon wie Kabul markieren solche weltpolitischen Zäsuren.
Der Westen hat viel Geld, aber wenig Ausdauer
In Vietnam wurde die Obsession des Kalten Kriegs zu Grabe getragen, der «freie Westen» müsse immer und überall einschreiten, um die weltweite Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern. Dominotheorie nannte sich das: Wenn Indochina fällt, fällt bald auch Westberlin.
In Afghanistan findet eine Fehleinschätzung ihr Ende, die 1989 ihren Anfang nahm. Die USA und ihre Nato-Partner schlüpften in die Rolle des Weltpolizisten. Mit humanitären Interventionen und harter Interessenpolitik erzwangen sie rund um den Globus Regimewechsel. Liberale Weltordnung nennt sich das: Der Westen muss für seine Werte einstehen und zum Schutz unterdrückter Völker deren Peiniger stürzen.
Eigentlich ist die liberale Weltordnung eine umgekehrte Dominotheorie, geboren aus der Euphorie über den Untergang der Sowjetunion. Nicht der Kommunismus breitet sich auf der Welt aus, sondern die Idee von Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft. In den fünfziger und sechziger Jahren fühlte sich der Westen noch bedrängt, er agierte aus der Defensive. Der Fall der Berliner Mauer aber wurde zur Geburtsstunde einer militärischen und politischen Offensive, in der sich Triumphalismus und Idealismus verbanden.
Wie viele Verirrungen begann auch diese mit den besten Absichten. In Somalia und Rwanda blamierten sich Uno-Blauhelme bis auf die Knochen, in Bosnien-Herzegowina konnte dies nur das militärische Eingreifen der USA verhindern. Die überlegene Feuerkraft der Nato bewirkte auf dem Balkan Gutes, und so wurde der Balkan zum Muster für alle Operationen.
Am Hindukusch gerieten allerdings die Kriegsziele durcheinander. Die Taliban wurden nach 9/11 vertrieben, weil sie der Kaida Unterschlupf geboten hatten. Die Invasion war ein legitimer Akt der Verteidigung und wie der ganze Krieg gegen den Terror ein Stück Macht- und Realpolitik wie aus dem Bilderbuch.
Bald allerdings änderte der Einsatz Charakter und Begründung. Er sollte die mittelalterlichen Lebensverhältnisse verbessern, den Frauen Gleichberechtigung bescheren und aus dem ethnischen Flickenteppich Afghanistan einen modernen Nationalstaat formen.
In der Logik des Verteidigungskrieges hätte ein baldiger Rückzug gelegen, spätestens nach der Tötung des Erzfeindes Usama bin Ladin. Das ehrgeizige Ziel des Nation-Building machte hingegen eine Präsenz weit über das Jahr 2021 nötig. Wenn man eine Gesellschaft von Grund auf verändern will, genügen zwei Dekaden nicht. Jede Transformation erfordert Ausdauer, doch gehört diese nicht zu den Stärken westlicher Demokratien. So entschied man sich für die schlechteste aller Varianten und verabschiedete sich auf halbem Weg.
Mal geht es um Werte, mal um Macht
Je nach Perspektive blieb man zu lang oder zu kurz in Afghanistan. Ihre Widersprüchlichkeit ist der zentrale Mangel der an sich so schönen Vorstellung einer liberalen Weltordnung. Sie will eine normative Ordnung sein, gebaut auf Werten wie universellen Menschenrechten, und ist zugleich Herrschaftsinstrument und kalte Interessenpolitik.
Der Vorwurf der Heuchelei ist daher mehr als nur blosse Propaganda. Weil der schillernde Begriff der liberalen Weltordnung aber letztlich unfassbar bleibt, ist er zugleich so populär. Hartgesottene Neokonservative wie George Bush konnten sich genauso dafür begeistern wie der Sozialdemokrat Tony Blair und der Grüne Joschka Fischer.
Die liberale Weltordnung wurde zur Ersatzideologie, als die Feindbilder des Kalten Kriegs zerstoben. Sie vereint Linke und Rechte. Folglich eignete sie sich bestens, um den Aussenseiter Trump auszugrenzen – obwohl Biden mit seinem Rückzugsbefehl genauso ihr Totengräber ist.
Feinde der liberalen Weltordnung sind nicht nur Autokratien und Parteidiktaturen wie Russland oder China, sondern die westlichen Staaten selbst: mit ihrer Inkonsequenz, ihrer Kurzatmigkeit und der Unfähigkeit, sich auf kohärente Strategien zu verständigen. Die Halbherzigkeit und der Mangel an Commitment erklären auch, wieso sich das stärkste Militärbündnis der Welt einem mit Sandalen und Mopeds gerüsteten Feind geschlagen gab.
Afghanistan führt dem Westen vor Augen, dass seine Werte, die er als seine grösste Stärke erachtet, vielleicht gar nicht so attraktiv sind. Jedenfalls gelang es ihm nicht, diese in den Köpfen der afghanischen Soldaten und Polizisten so weit zu verankern, dass sie ihrem Kampf gegen die Taliban einen Sinn gegeben hätten. Präsident Ghani floh als Erster. In der mit dem Fall von Kabul längst nicht beendeten Schlacht zwischen Islamismus und Aufklärung zeigten die Gotteskrieger mehr Kampfmoral.
Was sich hochtrabend Weltordnung nennt und damit einen Hauch von Ewigkeit beansprucht, ist tatsächlich nur ein kurzer historischer Ausnahmezustand: 30 Jahre, in denen ein einziger Staat – die USA – als globaler Hegemon agieren konnte.
Dies hat sich geändert. Nicht weil Amerika an Stärke, zumal an militärischer, eingebüsst hätte, sondern weil die anderen aufholen. Moskau, der ungelenke Riese in Europa, schüttelt seine postsowjetische Depression ab. Peking lässt eine 150-jährige Schwächephase hinter sich und will wieder das werden, was es einmal war, nämlich der Welt bedeutendstes Imperium: das Reich der Mitte.
Westliche Hybris hat in Afghanistan ein Vakuum geschaffen, das andere nun bereitwillig füllen. Russland unterhält seit langem gute Beziehungen zu den Islamisten. China hofiert die Taliban und winkt mit Investitionen. Die Kaida ist zwar vernichtet, aber die Region bleibt ein Epizentrum des Terrorismus. Der Sieg über die Ungläubigen wird den Jihadisten neue Anhänger zutreiben.
Weniger Enthusiasmus, mehr Realismus
Wenn Biden behauptet, er wolle sich auf die Gefahren von heute statt auf die Kriege von gestern konzentrieren, ist das ein durchsichtiger Rechtfertigungsversuch. Afghanistan ist fortan wie Vietnam ein Symbol amerikanischer Schwäche und mangelnder Zuverlässigkeit. Wer als Rivale oder Partner mit Washington zu tun hat, wird sich lange daran erinnern.
Das afghanische Debakel muss für die USA und ihre Verbündeten ein Anlass sein, um innezuhalten und sich in etwas zu üben, was nicht zu ihren Kernkompetenzen gehört – Bescheidenheit. Der Westen allein kann die Welt nicht retten. Washington ist nicht mehr der Praeceptor Mundi. London, Paris oder Berlin sind es erst recht nicht. Sie können der Welt keine Wertvorstellungen aufzwingen.
Wenn der Westen interveniert, muss er sich genau überlegen, wo er seine Mittel einsetzt. Vor allem sollte er nur für eine Sache kämpfen, an die er wirklich glaubt und die die Opfer wert ist. Sonst wird er sich wieder aus dem Staub machen. Überall sonst sollte er seine Militäreinsätze genau dosieren, auf lokale Hilfstruppen vertrauen und sich fragen, ob ein Engagement in seinem Eigeninteresse liegt.
2011 und 2012 waren die Kosten jeweils am höchsten
Kosten des Konflikts in Afghanistan für die USA, in Milliarden Dollar

Ob sich der Westen an solche Ratschläge hält? Wo immer hehre Ideale und grosse Ambitionen im Spiel sind, kann er nur schlecht widerstehen. Er verteidigt lautstark die Menschenrechte in China, erreicht damit aber wenig, weil auch flammende Rhetorik am Schluss nur Rhetorik ist. Die Europäer geben sich die strengsten Klimaziele und betrachten sich als Vorbild, während sich der Rest der Welt davon wenig beeindrucken lässt. Lernt der Westen keinen Realismus, wird er im unübersichtlichen 21. Jahrhundert viele Niederlagen erleiden.