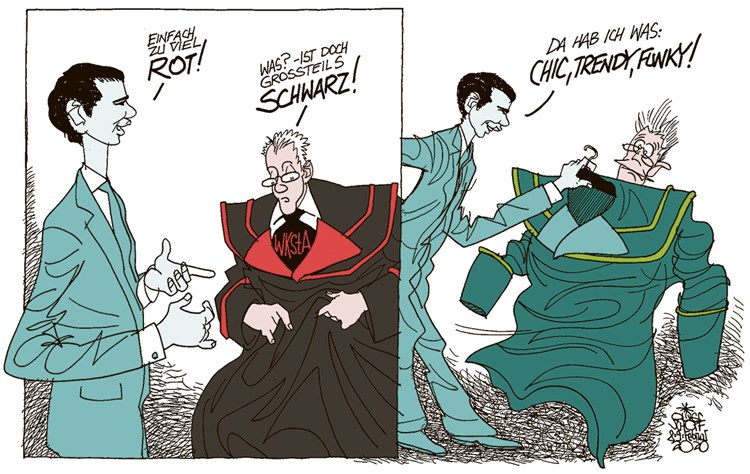Der Herbst zeigt sich am Blausee im Kandertal von seiner schönsten Seite. (Bild: Peter Schneider / Keystone)

Kaum
eine Jahreszeit übt auf die Menschen einen ähnlichen Zauber aus wie der Herbst. Er kündet die Vergänglichkeit an und versöhnt zugleich mit ihr.
Und plötzlich ist da ein kühler Hauch. Eine Verrückung hat stattgefunden, ein Wechsel der Atmosphäre. Eben noch hat man das tropfende Badezeug aufgehängt, schon bückt man sich nach der ersten Kastanie und spürt ihre seidene Haut. Die Klarheit des tiefblauen Himmels. So schmerzhaft schön wie im frühen Herbst ist das Licht zu keiner anderen Jahreszeit.
Am 23. September war Herbstbeginn, meteorologisch am 1. September, doch bis zum 28. Oktober gilt noch die Sommerzeit. Über achtzig Prozent der Teilnehmer haben jüngst bei einer EU-Umfrage für eine Abschaffung der Zeitumstellung plädiert. Sollte es in der Folge zu einer dauerhaften Installierung der Sommerzeit kommen, würde eine Stunde für immer aus unserem Leben getilgt. Wir verbrächten Herbst und Winter künftig zur Sommerzeit! Das könnte ein gutes Omen sein – würde nicht unser Lebenszeiger von einer undurchsichtigen technokratischen Macht verrückt.
Man kann natürlich darüber streiten, welches die schönste Jahreszeit ist – der Frühling mit seinem Blütenschaum und dem Jubilieren der aufbrechenden Natur, der Sommer mit seinem blauen Glücksversprechen, den warmen Nächten und dem Rendez-vous von Himmel und Meer. Oder der Herbst mit seinen flammenden Farben und der halluzinatorischen Durchsichtigkeit, die die Ferne ins Greifbare rückt. Auch der Winter kann schön sein, vor allem der erste Schnee, der die Welt vorübergehend in einen weissen Schlaf versenkt – obschon er, Tannenduft hin, Weihnachtsmarkt her, statistisch die ungeliebteste Jahreszeit ist.

Sonnenstrahlen durchbrechen ein Waldstück auf dem Gurnigel im Kanton Bern. Eben noch hat man das tropfende Badezeug aufgehängt, schon bückt man sich nach der ersten Kastanie und spürt ihre seidene Haut. (Bild: Peter Schneider / Keystone).
Gewinn und Verlust
Lange bevor es die Zeitrechnung gab, die das Leben in Nanosekunden einteilt, haben die Menschen in Jahreszeiten gedacht. Heute sorgen Gewächshäuser und die Globalisierung dafür, dass den Jahreszeiten das spezielle Aroma abhandenkommt, das einmal einen bestimmten Geschmack an einen Monat band. Spekulatius gibt es jetzt bereits im September. Doch auch wir Zeitgenossen der Nachmoderne sind von saisonalen Anhänglichkeiten nicht frei. Äpfel und Nüsse, Pilze und Feldsalat schmecken am besten im Herbst.
Es gehört zu den Folgen des Fortschritts, dass jeder Gewinn einen Verlust produziert und der Duft über den Landschaften nicht mehr auf dem Weg über die Zunge in unser Gedächtnis kommt. Das ist der Preis für die Schwemme an Erdbeeren von Mai bis Dezember, die nach gar nichts mehr schmecken und an nichts erinnern. Warten, bis etwas reif ist, ist in vielen Lebensbereichen ein Anachronismus geworden. Doch wie sehr wir auch den jahreszeitlichen Zyklen entfremdet sein mögen, tief eingegraben ist immer noch, dass man den Lebenszyklen die Merkmale von Jahreszeiten zuspricht. Zur «Hälfte des Lebens», die Hölderlin in bangen Versen beklagt, «hänget mit gelben Birnen das Land in den See».
Man kann auch darüber streiten, wer die schönsten Herbstgedichte geschrieben hat; Rilke – «die Blätter fallen wie von weit» –, Mörike, der jede Jahreszeit lyrisch verzaubern kann, oder Gottfried Benn, der die Verfallsmetaphorik in «Astern» in schwebende Verse fasste, mehr als zwanzig Jahre nachdem er unter dem Einfluss der «Verhaltenslehren der Kälte», die Helmut Lethen als die Signatur der Moderne ausmachte, in «Kleine Aster» das Seziermesser gezückt hatte. Ein toter Lastwagenfahrer war dem Doktor unters Skalpell gekommen, eine «dunkelhelllila» Aster im verwesenden Mund.
Ja, die Dichter haben den Herbst von allen Jahreszeiten schon immer am liebsten besungen, keine andere Jahreszeit ist metaphorisch so aufgeladen wie die Zeit des abnehmenden Lichts. Und doch ist es weniger die novembergraue Zeit des Totengedenkens, das «Weh mir» angesichts des kommenden Winters, das Hölderlins «Hälfte des Lebens» und Rilkes «Herbsttag» prägt, als vielmehr der Anfang des Herbstes, in den sich die Melancholie des Vergehens mischt. Es ist das «Noch einmal», das diese Jahreszeit für Emphase so anfällig macht: «Noch einmal in solchen Tagen verlockt der See; man spürt die Haut, wenn man jetzt schwimmt, die Wärme des eigenen Blutes, man schwimmt wie in Glas . . . für Augenblicke ist es, als stünde die Zeit in Seligkeit benommen, bevor sie in Asche und Dämmerung fällt» – schwärmt etwa der junge Max Frisch in «Stiller».

Der Herbst hält in Gestalt eines Buchenblatts Einzug auf dem Üetliberg. (Bild: Ennio Leanza / Keystone)
Die Zeit der Reife
Dass das Wort Herbst sprachgeschichtlich denselben Ursprung hat wie «harvest», das englische Wort für Ernte oder Ertrag, ist heute allenfalls noch auf dem Bauernhof und in den Weinbergen von Belang. Herbst ist auch Jagdsaison, und für das Kind, das ich war, ergab sich allherbstlich das schreckliche Paradox, dass die Eicheln, die wir im raschelnden Laub zur Winterfütterung für das Wild sammelten, mit den gebrochenen Augen der Rehe und Hirsche einhergingen, die um diese Zeit plötzlich im Keller des Forsthauses hingen, um dann zu Weihnachten auf unserem Teller zu landen.
Nun symbolisierte die Zeit der Reife und Ernte vormals auch den erfreulicheren Aspekt der zweiten Hälfte des Lebens, bevor das Spiel der Finanzjongleure die Renten auffrass. Unbeirrt von der Marktlogik der Konsumgesellschaft, in der die Asymmetrie zwischen Saat und Ernte systemisch ist, hält man in den USA das Erntedankfest mindestens nominell noch immer am vierten Donnerstag im November ab. Dass mit dem Schlachten von durchschnittlich 46 Millionen Truthähnen zu jedem «Thanksgiving» oft auch die Schlacht am Familientisch zusammengeht, bezeugen viele Romane und Filme.
Jonathan Franzen hat mit «Die Korrekturen» ein Paradebeispiel solcher Familien-Zerfleischung geschaffen, die jeden Herbst aufs Neue rund um den Puter aufflammt. Sollte man freilich einen Titel für diesen laufenden Herbst auswählen, würde man wohl eher bei Gabriel García Márquez fündig, der in seinem «Der Herbst des Patriarchen» das letzte Aufbäumen eines greisen Potentaten beschrieben hat.
Der Herbst erinnert daran, dass wir älter werden, das hat auch die 78-jährige Dame nicht unterbinden können, die anno 1989 gegen die Bundesrepublik Deutschland eine Beschwerde ob des schönen Wortes «Altweibersommer» eingereicht hat. Der Tatbestand der Diskriminierung wurde am 2. Februar des folgenden Jahres, am Tag der Altweiberfastnacht also, vom Landgericht Darmstadt abgeschmettert. Das Wort Altweibersommer leitet sich von den in der Septembersonne glitzernden Spinnweben her, die an die langen, silbergrauen Haare älterer Frauen erinnern sollen – oder dieses zumindest einst taten. Doch egal, ob anachronistischer Dutt oder praktischer Kurzhaarschnitt: Je älter wir werden, desto unnachgiebiger paktiert die Erinnerung mit der Jahreszeit.
Das gilt für historische Grossereignisse ebenso wie für private Einschnitte. So wird sich der vielbeschworene «tiefblaue Himmel» vom 11. September 2001 wohl noch lange über alle kommenden Herbste legen. Nirgends aber hat sich mir das lodernde Farbspektakel des Herbstes tiefer ins Gedächtnis gebrannt als in den Gärten der Tempel von Kyoto, wo das verglühende Rot des japanischen Ahorns am Rande des schimmernden weissen Kieses die Ahnung von einer ganz anders gearteten Lebenseinstellung aufkommen liess. Japan hat eine lange Tradition, die Jahreszeiten in eine poetische Form zu bringen. Die 17 Silben des Haiku enthalten immer ein Wort, das auf die Jahreszeit weist, das «kigo», das uns sagt, unter welchem Himmel, in welcher Temperatur und in welchem Licht wir uns wiederfinden.

Herbststimmung in Le Bois im Kanton Jura. (Bild: Valentin Flauraud / Keystone)
Poetische Expeditionen
Man könne vom Sommer am besten im Winter schwärmen, hat Jean Paul einmal gesagt und damit für die dichterische Phantasie formuliert, was auch für die Wahrnehmung der Jahreszeiten gilt: Sie ist zu grossen Teilen imaginär. So war es ein Schweizer Dichter, der die leuchtenden Farben des Indian Summer in Nordamerika so intensiv wie kein andrer beschrieben hat: der Schriftsteller Gerhard Meier aus Niederbipp, der nie in Amerika war.
Meiers «Baur und Bindschädler»-Tetralogie ist ein grosses November-Epos, eine Ode an den Monat der porzellanenen Winterastern und des pflaumenfarbenen Lichts. Ich kenne kein anderes Werk, das mit dem düstersten Monat des Jahres so restlos versöhnen kann wie diese poetischen Expeditionen ins herbstliche «Land der Winde». Es ist ein Land, in dem sich die Toten unter die Lebenden mischen und die «hörbar gewordene Zeit» im kosmischen Klang aufgeht, der, nach Baur, aus dem Sternbild der Jagdhunde stammt. Gut zu wissen, dass es am Himmel keine Hirsche und Rehe gibt.