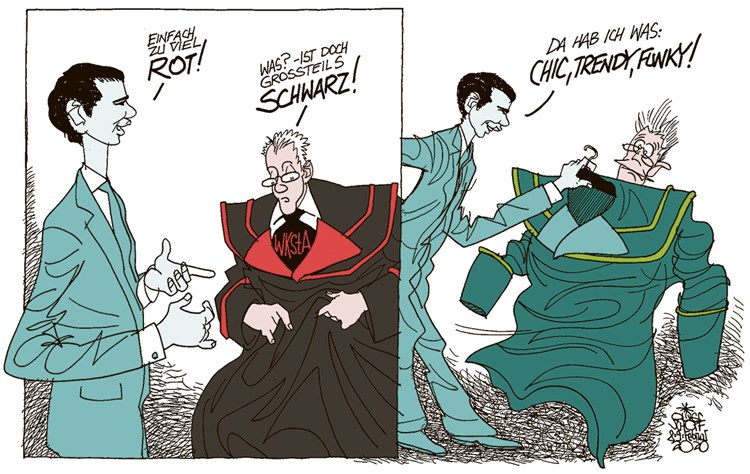Ille Gebeshuber: „Verstehen ist wichtiger als Wissen“

„Wiener Zeitung“: Frau Gebeshuber, wann haben Sie zuletzt über die Natur gestaunt?
Ille Gebeshuber: Ich staune jeden Tag und ich wäre verloren ohne mein Staunen. Es gibt so viele Wunder um uns herum, die normalerweise vom Alltag verdeckt werden. Ich habe mir vorgenommen, mir jeden Tag aktiv und bewusst Zeit zu nehmen, aus den vorgegebenen Bahnen auszubrechen und etwas Neues zu betrachten. Das muss nichts Großes sein. Das kann ein Blatt sein, eine Kastanie oder eine Alge. Vor ein paar Monaten war ich am Neusiedler See und konnte den Flug eines Schwarmes von Staren beobachten. Das war faszinierend.
Die Frage ist nicht, ob man staunt, sondern ob man sich die Zeit nimmt, zu staunen. Da sehe ich ein großes Problem: Viele Menschen können die schönen Dinge nicht mehr wahrnehmen. Ich mag den „Kleinen Prinzen“ sehr gern (von Antoine de Saint-Exupéry, Anm.). Der kommt zu einem Geschäftsmann, der die Sterne zählt und keine Zeit zum Träumen hat. Wenn wir uns alle mehr Zeit nehmen – und wenn es nur fünf Minuten sind – und uns zurücklehnen, an etwas anderes denken und uns teilweise von unseren Sachzwängen befreien, würde sich viel ändern.
Was würde passieren?
Wir wären viel begeisterter, am Leben zu sein. Es ist eine Gnade, ein Teil dieses Wunders zu sein. Als Physikerin und Nanotechnologin kenne ich ja nicht nur den sichtbaren Maßstab, sondern weiß, wie die Dinge im Mikroskop aussehen. Egal, ob man den eigenen Fingerabdruck oder einen Schmetterlingsflügel betrachtet – jedes Mal eröffnen sich neue Universen, die unendlich schön sind.
Aus den gewohnten Bahnen ausbrechen – dazu wurden wir alle im vergangenen Jahr gezwungen. Was können wir daraus lernen?
Wir Menschen haben unsere Unschuld im Umgang mit der Natur verloren. Vielleicht werden wir als Zivilisation auch einfach erwachsen – mit allen guten und schlechten Seiten des Erwachsenwerdens. Wir haben kollektiv über unsere Verhältnisse gelebt. Das gibt es in der Natur ja öfter. Meistens blühen diese Gemeinschaften kurzzeitig auf und sterben dann aus. Das wollen wir natürlich nicht.
Was läuft schief?
Wir haben ein riesengroßes, komplexes System aufgebaut – wenn man sich zum Beispiel die globalen Lieferketten ansieht. Alles hängt davon ab, dass Rohstoffe und Komponenten rechtzeitig geliefert werden. Jetzt merken wir, dass Naturkatastrophen, Pandemien oder Verteilungskriege das Potential haben, Ausfälle zu erzeugen. Das Drama ist, dass diese Ausfälle zu Kettenreaktionen führen und so eine weltweite Versorgungskatastrophe auslösen können. Manche sehen nur die vollen Supermarktregale und fühlen sich sicher. Aber dieser Bestand reicht nur für wenige Tage.
Was muss passieren?
Wir müssen aufwachen und im Einklang mit der Natur leben. Wir brauchen Systeme, die möglichst unabhängig von globalen Krisen funktionieren. Natürlich ist es schön, dass man sich Sachen aus China bestellen kann, die zwei Tage später geliefert werden. Aber das sind fragile Systeme, die leicht aus den Bahnen gebracht werden können. Die Katastrophe ist immer ums Eck. Ich glaube, wir realisieren inzwischen alle, dass wir so, wie wir es bisher gemacht haben, nicht weiterkommen. Daher habe ich als Optimistin Vertrauen in die Menschheit. Wir haben uns schon ein paar Mal neu erfunden, zum Beispiel während der Renaissance oder der Industriellen Revolution.

Nehmen wir einmal die Acantharia, das sind Strahlentierchen, die im Meer leben und ein Skelett besitzen, das dummerweise aus einem wasserlöslichen Material besteht. Diese Wesen können sich nicht entschließen, sich ein an ihre Umwelt besser angepasstes Skelett zu bauen. Sie sind in dem Weg gefangen, den sie einmal evolutionär eingeschlagen haben, und kommen nicht mehr heraus. Wir Menschen können dagegen innehalten, reflektieren und erkennen, dass wir uns verrannt haben. Und wir können einen neuen Weg einschlagen.
Und woher kommt der Impetus? Aus der Politik oder aus der Zivilgesellschaft?
Der Spätkapitalismus steuert seinem Ende zu. Das langfristige Denken und das Verständnis für Abhängigkeiten wird zunehmen und die Menschen werden es auch mehr fordern. Ich glaube, dass dieses Virus die Bereitschaft erhöht hat, aktiv zu werden und globale Initiativen zu starten, weil es alle Staaten betrifft. Und ich glaube, dass sich kurzfristige, populistische Politik, die nur bis zur nächsten Wahl denkt, von ganz alleine ad absurdum führt. Oder wenn aktiennotierte Unternehmen nur bis zum nächsten Aktionärsbericht planen.
Ich war jüngst auf einer UN-Jugendkonferenz im indischen Bangalore – und die neue Generation hat viele neue und kluge Forderungen. Die heutige Jugend wächst in einer ganz anderen Welt auf als die Generation vor ihr, die alles für selbstverständlich gehalten hat.
Sie schreiben, die heutige Flut an Wissen sei genauso schlecht wie blinder Glaube. Was meinen Sie damit?
Wissen ist heute leider nur eine andere Art von Glauben. Wir haben Terabyte an Daten, die generiert, gespeichert und verteilt werden. Diese riesigen Informationsmengen werden immer unübersichtlicher, weil wir nicht gelernt haben, mit ihnen umzugehen. Es wird zwar ausgesiebt, aber das ist nicht immer neutral. Viele kapitulieren und bauen sich mit Hilfe von Fake News eine Scheinwelt auf. Wir haben einen neuen Aberglauben und leben eigentlich in einem zweiten Mittelalter. Uns fehlt eine gemeinsame, gesicherte Wissensbasis. Früher war die Wissenschaft eine ordnende Kraft.
Heute leben die meisten Forschenden in einer Innovationsindustrie, in der es nicht mehr da-rum geht, die Dinge zu verstehen. Sondern darum, ständig neue Produkte in den Händen zu halten, die möglichst viel können. Und was machen wir damit – zum Beispiel mit unserem Smartphone, das immer schneller und besser rechnen kann? Wir vergeuden unsere so wertvolle Lebenszeit, indem wir in sozialen Medien surfen oder Online-Spiele spielen.
Was muss passieren?
Mein Traum ist ein Baum des Wissens. Ich liebe die alten Nachschlagewerke und sammle alte Brockhaus-Bände. Wir müssen ein Mindestwissen festlegen und dafür sorgen, dass die Menschen das verstehen. Wir müssen sie dazu ausbilden, aus diesem alten Wissen neues Wissen abzuleiten und vor allem auch zu verifizieren. Auch bei digitalen Enzyklopädien wie Wikipedia sollten wir einen Kern definieren – den die Menschen gemäß ihren Interessen anpassen können. Wir brauchen eine „Next Generation“-Wikipedia, die besser strukturiert ist. Gut verarbeitete Information ist wichtiger als eine Flut an Informationen. Verstehen ist wichtiger als Wissen.

Ihr Buch „Eine kurze Geschichte der Zukunft – Und wie wir sie weiterschreiben“ liest sich – neben vielen optimistischen Gedanken – auch wie eine recht gruselige Reise in die Zukunft: Wir werden einen Großteil unserer Zeit online verbringen, die direkte soziale Interaktion verkommt zum elitären Vergnügen.
Schon heute führt die Elite ein traumhaftes Leben: bequem, gesund und mobil. Die Unterschicht hingegen hat es alles andere als leicht. Viele suchen kleine Fluchten, zum Beispiel in TV-Serien oder Online-Spielen. Viele kennen schon jetzt alternative Welten, die vielen attraktiver erscheinen als die Gegenwart. Was sich fundamental ändern wird: Diese Welten werden immer interaktiver werden und die Möglichkeit bieten, eine komplett andere virtuelle Identität aufzubauen. Momentan spielt man online allein oder gegen ein paar andere Spieler. In Zukunft kann jemand, der – überspitzt formuliert – in seiner realen Welt unbekannt ist, in seiner virtuellen Welt zum Herrscher eines virtuellen Reiches werden.
Sie schreiben: „Wir werden Wanderer zwischen diesen beiden Welten sein.“
Vor einiger Zeit war ich für ein paar Tage offline. Als ich mich danach wieder in meine sozialen Netze eingeloggt habe, war das wie ein Hineinsinken in einen Freundeskreis. Dieses Gefühl hat sehr stark dem Gefühl geähnelt, das ich beim Autofahren in Malaysia hatte.
Was haben Sie da erlebt?
Bis ich dreißig Jahre alt war, habe ich nie ein Auto gehabt und war immer nur mit dem Fahrrad unterwegs – sogar in Kalifornien, wo ich einige Zeit gelebt habe. In Malaysia geht es nicht ohne Auto, weil die Distanzen zu groß sind und es keine öffentliche Verbindung gibt. Zu Fuß geht es auch nicht, weil es so heiß ist. Ich musste mir also zum ersten Mal ein Auto kaufen und habe dann angefangen zu zählen, wie oft ich pro Tag angehupt wurde. Das war meine Lernkurve. Die Malaien sind eine sehr rücksichtsvolle Gesellschaft – auch weil es nicht so etwas gibt wie unser „Pickerl“. Man muss immer damit rechnen, dass das Auto, das vor einem fährt, einen Schaden hat. Ich bin daraufgekommen, dass es wunderschön ist, inmitten dieser anderen Autos mit meinem eigenen Auto zu fahren und die Reaktion der anderen Leute auf mich zu spüren. Vor allem, weil man in Malaysia eher miteinander als gegeneinander fährt.
Wie beim Schwimmen in einem Schwarm – vergleichbar mit den sozialen Medien?
Genau. Als ich eine Zeit lang unterwegs war in anderen Ländern und nach Malaysia zurückkehrte, habe ich mich danach gesehnt, mich in mein Auto zu setzen und auf einer stark befahrenen Straße mit allen anderen zu fahren. Die Rückkehr in die sozialen Medien nach einer Pause war sehr ähnlich. In der Zukunft wird das echte körperliche Zusammentreffen ein Luxus sein, der individuelle Mobilität und eigenen Freiraum erfordert – zwei Ressourcen, die immer rarer werden. Aber die Zukunft hat mit ihren virtuellen Welten und Freiheiten eine Lösung parat. Der digitale Strandtraum der Armen muss nicht unbedingt schlechter sein als der Traumstrand der Reichen.
Die Qualitätsunterschiede zwischen Digitalem und Analogem werden verschwimmen?
Genau.
Macht Sie diese Vorstellung traurig?
Bei der digitalen Revolution handelt es sich nur um eine neue Technologie, die sich im Rahmen der Evolution des Werkzeuges ganz natürlich entwickelt hat. Ich sehe das neutral. Es liegt an uns, die Chancen der neuen Technologien weise zu nützen. Traurig machen mich aber zwei begleitende Entwicklungen. Zum einen haben unsere Systemexperten nur die kalte Logik in die künstlichen Intelligenzen einfließen lassen und die Menschlichkeit darüber vergessen. Mit einem Computer oder einem automatisierten System kann man nicht diskutieren, da hilft auch kein Flehen. Und es steht zu befürchten, dass diese extrem harte und unflexible Einstellung auch auf viele Teile unserer Gesellschaft reflektieren wird.
Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Ein weiteres Problem sehe ich in der totalen Digitalisierung. Sollten wir einen langfristigen totalen Stromausfall haben oder ein Supervirus, das den Zugang zu den Netzwerken blockiert, dann können wir die digitalen Archive nicht mehr lesen. Unmengen an Wissen könnten auf diese Weise verloren gehen. Wir sollten daran denken, an mehreren sicheren Orten eine Arche Noah von analogem Wissen zu retten, die auch Naturkatastrophen überstehen kann und mit der das vorhandene Wissen wiederhergestellt werden kann. Wir müssen – wie bei so vielen wichtigen Dingen – für Jahrtausende planen und nicht nur für wenige Jahrzehnte.
Sie waren die Erste in Ihrer Familie, die ein Gymnasium besucht und studiert hat. Wie war das für Sie?
Als ich mit 18 nach Wien gegangen bin, um technische Physik zu studieren, habe ich gedacht, dass sich für mich nun zwei völlig unterschiedliche Welten aufspannen werden. Dem war aber gar nicht so! Durch meine Ausbildung hat sich nicht viel verändert. Meine Eltern sind intelligente Menschen, denen nur aus sozialen Gründen ein Studium nicht möglich war. Indem sie mir und meinem Bruder die Möglichkeit gegeben haben, dass wir uns weiterbilden, haben sie sich selbst einen Traum erfüllt. Ich sehe meine Titel deshalb als gemeinsame Errungenschaft und ich empfinde keine intellektuelle Trennungslinie. Natürlich ist es schwer, ihnen zu erklären, was ich genau mache. In solchen Momenten wird mir die Abstraktheit meiner Tätigkeit bewusst. Jungen Menschen, die aus ähnlichen Verhältnissen stammen, rate ich erstens, jede Bildungschance zu nutzen, die sie kriegen können. Und zweitens, die eigenen Wurzeln nicht zu vergessen. Es ist wichtig, wohin man geht. Aber es ist auch wichtig, woher man kommt. Man darf die Basis nicht vergessen, die einen zu dem Menschen formt, der man ist.

Ille C. Gebeshuber wurde 1969 im steirischen Kindberg geboren. Sie ist Professorin für Physik an der Technischen Universität Wien und arbeitet in den Bereichen Nanophysik und Bionik. Sie hat einen offenen, transdisziplinären Ansatz und beschäftigt sich mit positiven Technologien, die den Menschen und der Biosphäre nutzen sollen. Dafür lässt sie sich auch gerne von ihren Beobachtungen im Dschungel Südostasiens inspirieren – sie lebte und arbeitete sieben Jahre in Malaysia. Ihr erstes populärwissenschaftliches Buch, „Wo die Maschinen wachsen“, wurde ein Bestseller, 2017 wurde sie „Österreicher des Jahres“ im Bereich Forschung. Kürzlich erschien ihr neues Buch: „Eine kurze Geschichte der Zukunft – Und wie wir sie weiterschreiben“ (Herder Verlag).
Saskia Blatakes, geboren 1981 in München, studierte Politikwissenschaft und arbeitet als freie Journalistin in Wien.